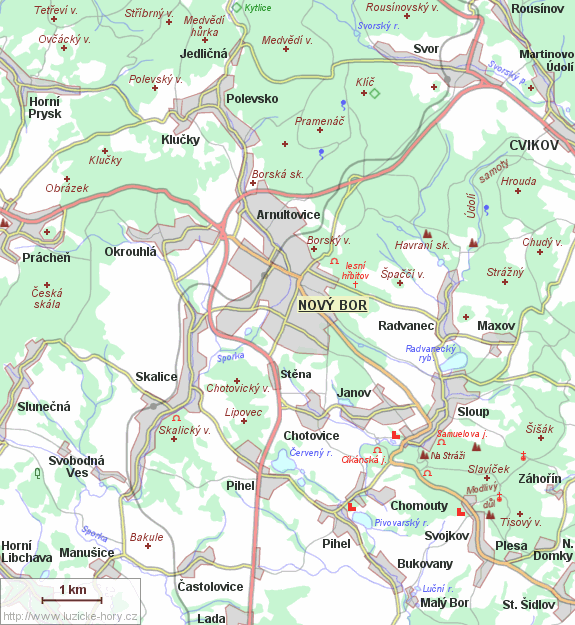Nový Bor
(Haida)

Blick auf den westlichen Teil der Stadt mit dem Berg Klíč vom Skalický vrch aus.
Foto: Jiří Kühn.
Nový Bor (Haida) liegt im weiten Tal der Sporka (Rohnbach) am südlichen Fuß des Lausitzer Gebirges, etwa 8 km nördlich von Česká Lípa (Böhmisch Leipa). Die relativ junge Stadt wurde als Zentrum der Textilproduktion gegründet, entwickelte sich jedoch bald zu einem Zentrum der Glasindustrie, die ihre Entwicklung bis heute geprägt hat. Zu der Stadt gehören auch die Ortschaften Arnultovice (Arnsdorf), Janov (Johannesdorf), Pihel (Pihl), Bukovany (Bokwen) und Chomouty (Komt), die Anfang 2014 zusammen 11962 Einwohner hatten.
Geschichte

Der Friedensplatz mit der Grundschule und der Kirche Mariä Himmelfahrt.
Foto: Jiří Kühn.
Die ursprüngliche Siedlung entstand auf dem Gelände des ehemaligen Bauernhofs von Raškovský, der zu Arnultovice gehörte. Dieser Hof blieb nach dem Dreißigjährigen Krieg verlassen, und die Grundherren richteten dort einen Gutshof namens Hayder Hof ein. Der Betrieb war jedoch unrentabel, weshalb der Besitzer des Sloup (Bürgstein) -Guts, Ferdinand Hroznata aus Kokořov (Kokorzow), den Hof 1692 auflöste und seine Grundstücke in 21 Parzellen aufteilte, die er an Landlose verkaufte. Um sicherzugehen, dass sich geeignete Käufer finden würden, ließ er auf allen Parzellen Holzhäuser errichten, die die Bewohner nach und nach abbezahlt haben. Der erste von ihnen war am 30. September 1692 der Schmied Jakub Runge aus Arnultovice. Nach ihm kamen weitere Siedler bis zum Jahr 1705, als das letzte der 21 Häuser bewohnt war. Im Jahr 1696 wurde an der Stelle des ehemaligen Schafstalls eine herrschaftliche Gaststätte errichtet, die auch einige amtliche Aufgaben übernahm. Der Gastwirt Wenzel Ignaz Grossmann kaufte die 1708 gepachtete Gaststätte und erwarb damit umfangreiche Grundstücke und das Vorrecht, Kleinwaren zu verkaufen, Brot zu backen und Vieh zu schlachten. Im Kaufvertrag vom 20. Januar 1708 wird erstmals der Name der neuen Siedlung Heyde erwähnt. Die ersten 17 Häuser der neuen Siedlung wurden entlang der heutigen T. G. Masaryk-Straße südlich des späteren Marktplatzes errichtet, wo damals ein Teil der Gebäude des Gutshofs stand. Die Gaststätte entstand an der Stelle des heutigen Restaurants Pošta, und die restlichen vier Häuser standen an der heutigen Sklářská- und Černá-Straße, etwa 300 m nordwestlich des Marktplatzes.
Im Jahr 1710 übernahmen die Kinskys das Gut in Sloup. Drei Jahre später hatte Bor bereits 90 Einwohner, darunter vor allem Maurer, Spinner und Tuchmacher. Nur drei Händler und ein Glasschleifer widmeten sich damals der Glasherstellung. Die Siedlung unterstand zunächst dem Vogt in Arnultovice, aber 1715 ernannte die Obrigkeit in Bor einen eigenen Vogt, Georg Günther, und einen Ratsherrn, Christoph Hölzel. Im Jahr 1723 wurden hier zwei weitere Häuser gebaut. 1732 wurde in Grossmanns Gasthaus eine Poststation eingerichtet. Weitere Bauarbeiten fanden auf dem zukünftigen Marktplatz statt. Im Jahr 1745 errichtete der Sohn des Gastwirts und Postmeister Johann Wenzel Grossmann eine Marienstatue und unterstützte in den Jahren 1747-1749 finanziell den Bau einer hölzernen Kapelle zur Himmelfahrt Mariens, in deren Turm eine Glocke aus der stillgelegten Rollhütte unter dem Jedlová (Tannenberg) gebracht wurde. Zur gleichen Zeit baute Grossmann gegenüber dem Gasthaus ein geräumigeres Haus und errichtete schließlich darunter noch eine Mühle. Im Jahr 1751 bauten die Kinsky hier einen zweistöckigen Getreidespeicher, der jedoch in dieser wenig fruchtbaren Gegend nie gefüllt wurde und nach einigen Jahren anderen Zwecken diente.

Das denkmalgeschützte Haus Nr. 46 in der T. G. Masaryk-Straße.
Foto: Jiří Kühn.
Im Jahr 1751 begann der Bau der Kaiserstraße von Prag über Česká Lípa nach Rumburk (Rumburg), deren Verlauf von der traditionellen Zittauer Straße über Sloup abwich und neu über die Hochebene nach Bor geführt wurde. Die Geländearbeiten begannen 1753. In den folgenden Jahren stagnierte der Bau, sodass der Abschnitt von Česká Lípa nach Bor erst um 1800 eröffnet wurde und die Fahrt nach Svor (Röhrsdorf) erst 1806 aufgenommen wurde. Mit Blick auf die neue Straße beschloss Graf Johann Josef Maxmilián Kinský, das wirtschaftliche Zentrum des Landguts von Sloup in das günstiger gelegene Bor zu verlegen. Der Graf förderte zu dieser Zeit vor allem die Textilproduktion und richtete neben der traditionellen Herstellung und Bleichung von Leinen auch eine Spinnerei, eine Fabrik für gezogenes Gewebe, eine Fabrik für Zwillich, Barchetwaren und feines Leinen, Wachsleinwand, eine Färberei und eine Kattunfabrik auf dem Gut ein. Für den Handel mit Textilprodukten benötigte er jedoch ein Handelszentrum, das er gerade in Bor errichten wollte. Auf seinen Antrag hin erhob Maria Theresia am 26. Februar 1757 das Dorf Haida zur Kleinstadt und erteilte ihr die Genehmigung für Wochenmärkte für Garn, Flachs und Getreide sowie für vier Jahrmärkte. Zu diesem Privileg fügte Graf Kinský am 15. September 1757 weitere Vorteile hinzu, die die Beziehungen zwischen der Obrigkeit und den Einwohnern regelten, die Testierfreiheit garantierten, die Bedingungen für den Erwerb des Bürgerrechts, die Gründung von Zünften, die Ausübung des Marktrechts, die Freizügigkeit und die Gemeindeverwaltung präzisierten.
Die erste Großhandelskompagnie wurde bereits 1754 in Bor gegründet, aber erst nach der Gründung der Stadt lockten die günstigen rechtlichen Bedingungen weitere Glasunternehmer aus den umliegenden Gemeinden an. Im Jahr 1763 verlegte der Händler Georg Anton Jancke sein Familienunternehmen aus Skalice (Langenau) hierher. 1775 wurde die Handelsgesellschaft „Hiecke, Rautenstrauch, Zinke und Co.“ gegründet, die an die ältere Gesellschaft von Christian Rautenstrauch in Polevsko (Blottendorf) anknüpfte. Drei Jahre später hatte Bor bereits 52 Häuser und der Marktplatz war von Häusern umgeben, unter denen das zwischen 1763 und 1765 erbaute Gebäude des Piaristenkollegs und der ehemalige gräfliche Getreidespeicher, der 1778 vom Skalicer Kaufmann Trauscek gekauft wurde, hervorstachen. Die Holzkapelle auf dem Marktplatz wurde im Juli 1784 durch einen Sturm so stark beschädigt, dass sie abgerissen werden musste und an ihrer Stelle eine neue Kirche, die Kirche Mariä Himmelfahrt, errichtet wurde, die am 15. August 1792 geweiht wurde. Zusammen mit ihr wurde 1786 am nordöstlichen Rand von Bor ein Friedhof angelegt.
Weitere Häuser wurden vor allem in den Straßen gebaut, die nach Česká Lípa und Sloup führten, aber das reichte nicht aus. Deshalb beauftragte Filip Kinský bereits 1781 den königlichen Ingenieur Emanuel Kleinwächter, der einen Plan für den weiteren Ausbau entwarf. Im März 1787 wurde östlich der Straße nach Česká Lípa ein neuer Marktplatz angelegt, um den herum innerhalb weniger Jahrzehnte ein stilistisch einheitliches klassizistisches Viertel entstand, das nach dem damaligen englischen Ideal einer Gartenstadt gebaut wurde.

Die Purkyňova-Straße.
Foto: Jiří Kühn.
Die vielversprechende Entwicklung wurde durch die Napoleonischen Kriege unterbrochen. Im August 1813 tauchten in der Umgebung von Bor napoleonische Patrouillen auf, die mit österreichischen Husaren zusammenstießen. Bei Pihel kam am 20. August Jean Henri de Valmont ums Leben, der am Hang des Chotovický vrch (Kottowitzer Berg) begraben wurde. Direkt in Bor wurde am 23. August der Unteroffizier Štěpán Holička tödlich verwundet, dessen sterbliche Überreste später in der Kapelle auf dem alten Friedhof beigesetzt wurden. Im September marschierte die russische Armee durch die Stadt, deren Aufenthalt die Lebensmittelvorräte vor dem Winter vollständig erschöpfte. Die Glasherstellung wurde von einer Handelsblockade getroffen, unter der praktisch alle Unternehmen zu leiden hatten. Viele Maler, Schleifer und Graveure mussten wieder zur Heimweberei zurückkehren. Die Wiederbelebung der Glasherstellung ist vor allem Friedrich Egermann zu verdanken, dessen Produkte mit der ausländischen Konkurrenz mithalten konnten.
Im Jahr 1850 fand eine Verwaltungsreform statt, dank der sich die kleine Stadt zu einem Verwaltungszentrum für die gesamte Umgebung entwickelte. In Bor wurde ein Bezirksgericht eingerichtet und das Rathausgebäude für die Bedürfnisse weiterer Behörden umgebaut. Bald darauf entstanden in der Stadt neue Glasfabriken. Bereits 1850 gründete J. Vogelsang hier eine Niederlassung der Handelsfirma aus Frankfurt am Main, die sich um den Absatz der Produkte der örtlichen Glasmacher, darunter auch Egermann, kümmerte. Auch Josef Grohmann aus Chřibská (Kreibitz) und August Hegenbarth aus Mistrovice (Meistersdorf) ließen sich in der Stadt nieder, Reinhold Palme eröffnete hier 1859 eine Niederlassung der alten Kronleuchterfirma aus Prácheň (Parchen) und ein Jahr später verlegte Anton Pelikan aus Mistrovice sein Unternehmen hierher. In den 1860er Jahren entstand hier die bedeutende Glasfabrik Julia Mühlhause und Carl Hosch verlegte seine Kronleuchterproduktion aus Zákupy (Reichstadt) hierher.
Im Juni 1866 brach der Preußisch-Österreichische Krieg aus, während dessen die Stadt die preußische Armee versorgen musste, die an der Straße nach Svor lagerte. Ende August/Anfang September kehrten die Preußen wieder nach Hause zurück. Die weitere Entwicklung wurde durch die Eröffnung der Eisenbahnstrecke von Česká Lípa nach Rumburk am 16. Januar 1869 gefördert. Die Stadt hatte damals 2069 Einwohner und es wurde wieder in größerem Umfang gebaut. Innerhalb von 15 Jahren entstanden in Bor und Arnultovice rund 80 neue Gebäude und eine Reihe älterer Bürgerhäuser wurden umgebaut. Im Jahr 1880 hatte Bor bereits 266 Häuser mit 2737 Einwohnern und zusammen mit Arnultovice 547 Häuser und 5220 Einwohner. Beide Gemeinden waren zu dieser Zeit baulich vollständig miteinander verschmolzen, aber die Einwohner von Arnultovice wehrten sich bis 1942 gegen eine administrative Zusammenlegung.
In den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts begann sich ein Mangel an Rohstoffen für die Glasherstellung bemerkbar zu machen, die aus immer weiter entfernten Orten importiert werden mussten. Dank der neuen Technologie der Beheizung der Öfen mit Kohle und dem günstigeren Transport per Eisenbahn konnten jedoch neue Glashütten in Kamenický Šenov (Steinschönau), Kytlice (Kittlitz), Polevsko, Skalice oder Svor gebaut werden, und auch in Bor wurde am 25. April 1874 die Glashütte „König, Werner und Co.” eröffnet, die nach 10 Jahren von Eduard Michel gekauft wurde. Von den neu gegründeten Glasbetrieben waren beispielsweise das 1874 gegründete Unternehmen der Brüder Rachman, die 1888 aus Okrouhlá (Schaiba) hierher umgezogene Firma „Hartmann und Dietrichs” und die 1895 gegründete Glashütte von Josef Alois Eduard Zahn bedeutend.

Fachschule für Glasherstellung in Nový Bor.
Foto: Jiří Kühn.
Mit der wachsenden Bedeutung der Stadt verbesserte sich auch ihre Infrastruktur. Ende August 1882 wurde in Bor feierlich die Wasserversorgung eröffnet, die aus ergiebigen Quellen unterhalb des Klíč (Kleis) gespeist wurde. 1894 nahm das städtische Elektrizitätswerk seinen Betrieb auf. Auch das Schulwesen entwickelte sich weiter, dessen Grundlage neben dem Piaristenkolleg die 1763 von Michael Richter im Haus Nr. 68 in der Liberecká-Straße gegründete Volksschule bildete. Im Jahr 1806 wurde sie durch die neu erbaute Stadtschule Nr. 176 in der heutigen Palackého-Straße ersetzt, von wo aus die Schüler nach der Schließung des Piaristenkollegs im Oktober 1870 in dessen Gebäude am Marktplatz umzogen. Hier wurde auch eine neue Fachschule für Glasherstellung eröffnet. Nach der Renovierung des Gebäudes in den Jahren 1886–1887 nahm hier neben der Grundschule auch eine städtische Jungenschule ihren Betrieb auf, ab 1892 auch eine städtische Mädchenschule, während die Glasfachschule in Ersatzräume umzog und im September 1892 den Unterricht in einem neuen Gebäude in der Wolkerova-Straße aufnahm, wo sie bis heute ihren Sitz hat. Am 14. März 1893 wurde im Rathaus das Glasmuseum eröffnet.
Die Stadt dehnte sich weiter in Richtung Bahnhof und um das klassizistische Viertel auf der Ostseite der Straße nach Česká Lípa aus, wo der Bau auch auf das Gebiet des benachbarten Chotovice (Kottowitz) übergriff. Im Jahr 1873 entstanden hier an der damaligen Straße „Kammweg“ die ersten 8 Gebäude, und 30 Jahre später hatte Nové Chotovice bereits 48 Häuser. Am 1. Januar 1924 wurde die Siedlung Teil der Stadt, die später den Namen Hřebenka erhielt.
In den Jahren 1900–1902 wurde in Bor ein Krankenhaus gebaut, in der Nähe des Parks entstand eine evangelische Kirche, die nach einem Brand 1982 abgerissen wurde, und 1904 wurde an der Ecke des Marktplatzes ein prächtiges Sparkassengebäude fertiggestellt. Im Jahr 1909 wurde der alte Friedhof von Bor geschlossen und auf einem weitläufigen Gelände an der Straße nach Radvanec (Rodowitz) ein neuer Waldfriedhof angelegt. Am 1. Oktober 1911 wurde bei der Glasfachschule eine Schulhütte eröffnet, und am 23. Januar 1913 nahm die Glashütte Flora ihren Betrieb auf, die 1935 von der Firma Hantich übernommen wurde.

Denkmal an der Stelle der Hinrichtung der Teilnehmer des Aufstands von Rumburk hinter dem Waldfriedhof.
Foto: Jiří Kühn.
Am 20. Oktober 1913 gelang es der Stadt, die Ankunft des deutschen Luftschiffs Sachsen aus Leipzig in Bor zu vereinbaren. Aufgrund ungünstiger Wetterbedingungen wurde der Flug jedoch verschoben. Er fand erst am 9. November auf einer Ersatzroute aus dem schlesischen Lehnice (Liegnitz) statt. Bor wurde damit zum Ort der ersten Landung eines Luftschiffs in Böhmen.
Im folgenden Jahr brach der Erste Weltkrieg aus. Am 15. Januar 1916 wurde in der Stadt eine Militärgarnison eingerichtet, deren Hauptquartier bis 1919 im Haus Nr. 12 in der damaligen Poštovní třída (Poststraße) untergebracht war. Vor Kriegsende kam es am 21. Mai 1918 in Rumburk zu einem Militärputsch. Die aufständischen Soldaten marschierten über das Lausitzer Gebirge nach Bor, nahmen bei Polevsko eine Patrouille der Grenzjäger gefangen und stießen in Arnultovice (Arnsdorf) auf eine Kompanie Grenzjäger, die sich nach einem kurzen Kampf zum Chotovický vrch (Kottowitzer Berg) zurückzog. Die Rebellen marschierten dann in die Stadt ein, besetzten das verlassene Militärhauptquartier und machten sich anschließend auf den Weg nach Česká Lípa. Unterhalb des Chotovický vrch stießen sie jedoch auf die Truppen des Borsker Landrats Flibor, die durch Soldaten des 18. Infanterieregiments aus Česká Lípa verstärkt worden waren. Nach einem kurzen Kampf ergaben sich die meisten Rebellen, die übrigen flohen in die Umgebung, wo sie in den folgenden Tagen gefasst wurden. Die drei Anführer der Rebellen wurden am 28. Mai in Rumburk zum Tode verurteilt und am folgenden Tag hinter dem dortigen Friedhof hingerichtet. Weitere 21 Rebellen wurden am 29. Mai in Bor zum höchsten Strafmaß verurteilt, das bei 14 von ihnen in Festungsstrafen von fünf bis zehn Jahren umgewandelt wurde. Die übrigen sieben Verurteilten wurden am Abend hinter dem Waldfriedhof hingerichtet.

Genossenschaftshäuser tschechischer Einwohner aus den 1920er Jahren in der Česká-Straße.
Foto: Jiří Kühn.
Nach Kriegsende kam es zu einer erneuten Belebung der Glasherstellung. Aus dem tschechischen Landesinneren kamen weitere Glaser in die Stadt, die am östlichen Stadtrand ein neues tschechisches Viertel errichteten. Am 8. November 1925 wurde der Grundstein für eine tschechische Schule gelegt, die am 27. Mai 1928 feierlich eröffnet wurde. Im Jahr 1926 bauten die Brüder Zimmerhackel unweit des Marktplatzes ein modernes, repräsentatives Hotel. Zur gleichen Zeit entstand im Gemeindegebiet von Skalice südwestlich der Stadt die Siedlung Nová Skalice, die nach dem Zweiten Weltkrieg Teil von Bor wurde.
Ende 1929 begann die Wirtschaftskrise und die Fabriken mussten ihre Produktion einschränken. Im Juni 1932 erlosch in Bor die letzte Hantich-Hütte und die Produktion in den Raffinerien kam fast zum Erliegen. Eine allmähliche Belebung der Produktion erfolgte erst 1934, als jedoch in Deutschland der Nationalsozialismus an Stärke gewann. Unter seinem Einfluss nahmen die nationalen Spannungen im Grenzgebiet zu, die im September 1938 in einer Reihe von bewaffneten Auseinandersetzungen gipfelten. Anfang Oktober wurde das tschechische Grenzgebiet von Deutschland besetzt. Am 3. Oktober marschierte die nationalsozialistische Armee in Bor ein. Drei Tage später besuchte auch Adolf Hitler die Stadt.
Im März 1939 besetzte Deutschland auch den Rest der Tschechoslowakei. Im September begann der Zweite Weltkrieg. Die meisten Unternehmen mussten sich daher auf die Kriegsproduktion umstellen. Die wehrfähigen Männer der Stadt zogen an die Front. An ihre Stelle traten Kriegsgefangene, die die fehlenden Arbeiter in der Produktion und später auch in der Landwirtschaft ersetzen sollten. Ab 1942 wurden auch Zivilisten aus den besetzten Staaten zu Zwangsarbeit herangezogen, für die in Arnultovice ein Arbeitslager errichtet wurde.

Prächtiges Hotelgebäude aus dem Jahr 1926.
Foto: Jiří Kühn.
Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurde der Großteil der ursprünglichen deutschen Bevölkerung von Bor vertrieben und tschechische Siedler aus dem Landesinneren kamen in die Stadt. Die Wiederaufnahme der Produktion in den Glashütten wurde nicht nur durch den Mangel an Rohstoffen und Energie erschwert, sondern auch durch den Mangel an Glasfachleuten und Unternehmern. Durch den Zusammenschluss einer Reihe kleinerer Betriebe entstand 1945 das Staatsunternehmen Borocrystal, aus dem später das Staatsunternehmen Borské sklo hervorging. Am 9. Februar 1948 wurde die Stadt Bor offiziell in Nový Bor umbenannt.
In den Jahren 1965 bis 1967 errichtete der jugoslawische Unternehmensverband Union Engineering westlich des Bahnhofs einen neuen Fabrikkomplex, in dem die Glashüttenproduktion und die Glasveredelung konzentriert waren. Er wurde vom Unternehmen Borské sklo betrieben, das 1974 in Crystalex umbenannt wurde. In den 70er und 80er Jahren entstanden in der Stadt neue Plattenbauten, für die ein Teil der historischen Bebauung an der Hauptstraße T. G. Masaryka und in der Umgebung der Husova-Straße abgerissen wurde. Dennoch behielt der Stadtkern seinen historischen Wert und wurde 1992 zum städtischen Denkmalschutzgebiet erklärt.
Im Jahr 1981 wurde Nový Bor zum Grundzentrum, zu der die umliegenden Dörfer Chotovice, Okrouhlá, Polevsko, Radvanec, Skalice, Sloup, Slunečná (Sonneberg) und Svojkov (Schwoika) zwangsweise angegliedert wurden, die sich nach dem politischen Umbruch im November 1989 wieder verselbstständigten. Nach 1989 brach auch das staatliche Monopol in der Industrie zusammen und in der Stadt entstanden wieder private Glasunternehmen wie Egermann, Crystal, Ajeto, Slavia und andere. Das größte Unternehmen, Crystalex, wurde Ende der 90er Jahre Teil der Glasgruppe Bohemia Crystalex Trading, nach deren Konkurs die Glashütte 2009 von der Gruppe CBC Invest gekauft wurde, die dort die Produktion von Gebrauchsglas unter dem Namen Crystalex CZ wieder aufnahm. Nový Bor bleibt somit ein bedeutendes Zentrum der Glasherstellung, zu dessen Bekanntheit auch internationale Glassymposien beitragen, die seit 1982 Glaskünstlern aus aller Welt ein kreatives Umfeld bieten.
Denkmäler und Merkwürdigkeiten

Kirche Mariä Himmelfahrt..
Foto: Jiří Kühn.
In der südöstlichen Ecke des Marktplatzes steht die spätbarocke Kirche Mariä Himmelfahrt, die an der Stelle einer älteren Holzkapelle errichtet wurde, die der Gastwirt Johann Wenzel Grossmann in den Jahren 1747–1749 bauen ließ. Nach dem Sturm vom 17. Juli 1784 wurde die beschädigte Kapelle abgerissen und im Mai 1786 mit dem Bau einer neuen Kirche begonnen. Der Rohbau wurde im Oktober 1787 vom Děčín-Baumeister Jan Václav Kosch fertiggestellt, ein Jahr später wurde der Turm fertiggestellt und am 15. August 1792 weihte der Bezirksvikar Johann Christoph Preisler die Kirche.
Das Gebäude besteht aus einem ovalen, mit einer Kuppel überdachten Kirchenschiff, an das sich ein halbkreisförmiges Presbyterium mit zwei zweistöckigen Anbauten anschließt. An der Westfassade befindet sich ein 60 m hoher prismatischer Turm, der mit einer Kuppel mit zwei Laternen gekrönt ist. Die Innenausstattung stammt aus dem Ende des 18. Jahrhunderts. Der Hauptaltar aus dem Jahr 1792 mit plastischen Verzierungen und vergoldeten Engelsfiguren des Prager Bildhauers Ignaz M. Platzer dem Jüngeren schmückt das Gemälde „Mariä Himmelfahrt“ des Meisters Anton Donat aus Frýdlant. Dieser malte auch die Bilder der Heiligen Rosalia und des Gründers des Piaristenordens Josef Kalasantský auf den beiden Seitenaltären, die 1793 vom Bildhauer Antonín Max aus Sloup und dem Tischler Jakub Lischka aus Bor geschaffen wurden. Von Antonín Max stammt auch die reich verzierte hölzerne Kanzel aus den 90er Jahren des 18. Jahrhunderts.
An den Seiten des Hauptaltars befinden sich Statuen des Heiligen Herzens Jesu und der Jungfrau Maria, das Taufbecken mit einer Statue des Heiligen Johannes des Täufers stammt aus dem Ende des 18. Jahrhunderts. Das Bildnis Christi am Kreuz ist eine Kopie des Originals aus dem Petersdom in Rom, angefertigt von Václav Mánes, und die Bilder der Kreuzwegstationen aus dem Jahr 1830 stammen vom Maler Franz Liebich aus Zákupy. Die Ausstattung wird durch Glasleuchter lokaler Hersteller und Buntglasfenster mit Darstellungen der Madonna und des Heiligen Johannes des Täufers von Karel Meltzer aus Skalice ergänzt. Im Chor befindet sich eine Rokoko-Orgel mit Engelskapelle, die aus der aufgelösten Kirche St. Karl Borromäus in Prag hierher gebracht wurde, und im Turm ist auch eine alte Glocke aus dem Jahr 1607 erhalten geblieben.
Hinter der Kirche steht eine Statue der Jungfrau Maria von Franz Werner, die der Gastwirt Johann Wenzel Grossmann als Dank dafür anfertigen ließ, dass die Gemeinde während des Ersten Schlesischen Krieges von 1740 bis 1742 von den Verwüstungen der Armeen verschont geblieben war. Die am 5. August 1745 geweihte Statue ist das älteste Denkmal der Stadt.

Innenraum der Kirche Mariä Himmelfahrt.
Foto: Jiří Kühn.

Statue der Jungfrau Maria hinter der Kirche.
Foto: Jiří Kühn.

Grundschulgebäude auf dem Marktplatz.
Foto: Jiří Kühn.
Auf dem Platz neben der Kirche steht ein großes Grundschulgebäude, das durch den Umbau des ursprünglichen Piaristenklosters entstanden ist. Der Grundstein für das Piaristenkloster wurde am 3. September 1763 gelegt. Der Bau wurde am 4. November 1765 fertiggestellt. Nach seiner Auflösung wurde am 1. Oktober 1870 die Volksschule hierher verlegt und eine neue Glaserschule eröffnet. In den Jahren 1886–1887 wurde das Gebäude nach den Plänen von Ignaz Dittrich um ein zweites Stockwerk erhöht und in seine heutige Form umgebaut.
In der Nachbarschaft der Schule steht das Empire-Gebäude des Glasmuseums, das 1804 vom Kaufmann Johann Christoph Socher erbaut wurde. Das zweistöckige Haus mit Mansarddach ziert ein prächtiges spätbarockes Sandsteinportal, in dessen Giebel sich ein Anker befindet, der den Überseehandel symbolisiert. In einer Nische an der Seitenwand befand sich früher eine Statue des Heiligen Johannes Nepomuk. In den 1820er Jahren kaufte der Kaufmann Stephan Rautenstrauch das Haus, das bis 1939 im Besitz seiner Familie blieb, bevor es von der Stadt erworben wurde.
Das Glasmuseum in Bor wurde vom Gewerkschaftsverband der Arbeiter der Glas- und Keramikindustrie gegründet. Seine ursprüngliche Sammlung, die aus Spenden lokaler Glasmacher entstand, wurde am 14. März 1893 im Rathaus der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Nach 1938 wurde das Museum geschlossen und 1952 wurde seine Ausstellung in das heutige Haus Nr. 105 verlegt, das 1999 renoviert und im Oktober 2012 um einen neuen Anbau erweitert wurde, der es mit dem benachbarten Haus Nr. 106 verbindet, in dem im Herbst 2021 ein Informationszentrum eröffnet wurde. Das Museum präsentiert heute die historische Entwicklung der Glasherstellung in der Region Nový Bor mit Beispielen verschiedener Veredelungstechniken. In seinen Sammlungen finden wir auch Kunstwerke zahlreicher Glaskünstler und interessante Arbeiten der örtlichen Glasfachschule.
In der Kalinova-Straße hinter dem Museum befindet sich das Fachwerkhaus Nr. 109 mit einem Mansarddach, in dem der Nationaldichter Josef Jaroslav Kalina geboren wurde.

Glasmuseum.
Foto: Jiří Kühn.

Geburtshaus von Josef Jaroslav Kalina in der Kalinova-Straße.
Foto: Jiří Kühn.

Gebäude der Stadtverwaltung.
Foto: Jiří Kühn.
Die nordwestliche Ecke des Platzes wird von einem mächtigen zweistöckigen Gebäude der Stadtverwaltung mit Mansarddach und einem prächtigen Eingangsportal dominiert. Es wurde 1751 als herrschaftliche Kornkammer erbaut und sechs Jahre später zu einer Weberei mit Lager für Leinen und Garn umgebaut. Im Jahr 1778 kaufte der Skalicer Kaufmann Johann Anton Trauscek das Haus, nach dessen Tod es wieder in den Besitz des Grafen Filip Kinský überging und am 27. September 1821 von der Stadt gekauft wurde, die darin ein Amtsgebäude einrichtete. Im Jahr 1850 wurde das Haus zum Sitz des Bezirksgerichts und des Finanzamtes, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde hier ein Gefängnis eingerichtet und kurz darauf auch eine Gendarmeriestation und eine Stadtpolizeistation. In den Jahren 1870 bis 1878 war hier auch eine Zeichenschule untergebracht, von 1875 bis 1904 die städtische Sparkasse und am 14. März 1893 wurde im Gebäude eine Ausstellung des Glasmuseums eingerichtet.
In der südwestlichen Ecke des Marktplatzes steht das monumentale zweistöckige Postgebäude, das zwischen 1903 und 1904 erbaut wurde. Das Jugendstilgebäude mit seinem markanten roten Putz wurde vom Baumeister Emil F. Rühr aus Česká Lípa entworfen und von der Firma Josef Schneider gebaut. Ursprünglich schmückte eine prächtige Kuppel das Gebäude, die jedoch zu schwer war und daher Ende der 1930er Jahre entfernt werden musste.
Auf der West- und Nordseite des Platzes befinden sich mehrere denkmalgeschützte Bürgerhäuser mit Mansarddächern und verzierten Eingangsportalen, die überwiegend aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts stammen. Eine Gedenktafel am Haus Nr. 101 erinnert daran, dass hier der bedeutende Glasunternehmer und Erfinder Friedrich Egermann lebte.

Repräsentatives Postgebäude auf dem Marktplatz.
Foto: Jiří Kühn.

Häuser auf der Westseite des Marktplatzes.
Foto: Jiří Kühn.

Das ehemalige Hotel „U města Vídně“, in dessen Saal die Deckenmalereien von Josef Navrátil erhalten geblieben sind.
Foto: Jiří Kühn.
Südlich des Platzes beginnt die Masarykova třída, deren historische Bebauung in den 70er und 80er Jahren des 20. Jahrhunderts größtenteils abgerissen und durch neue Plattenbauten ersetzt wurde. Auf der linken Straßenseite sind die denkmalgeschützten Häuser Nr. 4, 5 und 6 erhalten geblieben, von denen das mittlere mit einem Steinportal mit der Jahreszahl 1804 verziert ist. Ein Stück weiter rechts steht das zweistöckige Haus Nr. 46 mit einem Halbmansarddach. Das ursprüngliche Haus aus dem Jahr 1699 wurde zwischen 1771 und 1797 vom Glashändler Wenzel Hölzel umgebaut und 1888 um einen gemauerten Flügel erweitert. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts verfiel das Haus und wurde in den 90er Jahren renoviert.
Das Nachbarhaus Nr. 45 entstand in den Jahren 1836–1837 durch den Umbau eines älteren Hauses aus dem Jahr 1723. Der Weinhändler Josef Kalasantský Gerner eröffnete darin das Hotel „U města Vídně“ (Bei der Stadt Wien), das August Hegenbarth nach 1856 für die Bedürfnisse der Glasherstellung und des Handels umbauen ließ. Im großen Saal im 1. Stock ist jedoch die ursprüngliche Decke erhalten geblieben, die zwischen 1853 und 1856 mit Gemälden des bedeutenden tschechischen Malers Josef Navrátil verziert wurde, der zu dieser Zeit auf dem Schloss in Zákupy arbeitete. In den Jahren 1995–1996 wurde der Navrátil-Saal restauriert. Heute finden dort verschiedene kulturelle und gesellschaftliche Veranstaltungen statt.
Von historischem Wert sind auch die benachbarten Häuser Nr. 43, 42 und etwas weiter entfernt das Haus Nr. 35. Etwa 200 Meter weiter befindet sich auf der linken Straßenseite das Gebäude der Sokolhalle mit Turm, das in den Jahren 1880–1881 nach den Plänen des Dresdner Baumeisters Bernard Schreiber erbaut wurde.

Sitz des bedeutenden Glas- und Designunternehmens Lasvit am Palackého-Platz.
Foto: Jiří Kühn.
Ein bemerkenswertes architektonisches Ensemble bildet das klassizistische Viertel im südöstlichen Teil der Stadt, das nach den Plänen des königlichen Ingenieurs Emanuel Kleinwächter aus dem Jahr 1783 erbaut wurde. Hier wurden größtenteils Fachwerkhäuser mit Umgebinde gebaut, die das Fachwerkgeschoss mit Mansarden- oder Halbmansarddach stützten und deren Eingang in der Regel durch ein prächtiges Steinportal verziert war. Die meisten davon finden wir auf dem Palackého-Platz und in den angrenzenden Straßen Palackého, Alšova und Tkalcovská. Ähnliche Häuser bauten sich wohlhabende Glaser und Kaufleute beispielsweise auch in Polevsko, Prácheň oder Kamenický Šenov. Auf der Nordseite des Palackého-Platzes wurde in den Jahren 2017-2019 nach einem Entwurf der Architekten Jiří Opočenský und Štěpán Valouch der Sitz des bedeutenden Glas- und Designunternehmens Lasvit errichtet. Zwischen zwei schön renovierten Fachwerkhäusern aus dem Jahr 1790 wurden zwei moderne Neubauten errichtet. In dem mit halbtransparenten Platten verkleideten Glashaus, das an alte Schieferverkleidungen von Giebeln und Dächern erinnert, befindet sich ein Saal mit einer Ausstellung von Glasobjekten, die tagsüber von außen beleuchtet werden, während sie nach Einbruch der Dunkelheit hinterleuchtet sind und durch die Glaswand des Hauses nach außen leuchten. Im hinteren Teil des Grundstücks steht das Schwarze Haus mit einem 13 m hohen Raum mit Kranbahn, der für Tests und Präsentationen neu geschaffener Glasobjekte vorgesehen ist. Im Park am Palackého náměstí steht eine etwa 200 Jahre alte und 24 m hohe Stieleiche, die 2009 zum Denkmalbaum erklärt wurde.

Eines der denkmalgeschützten Häuser am Palackého-Platz.
Foto: Jiří Kühn.

Das denkmalgeschützte Haus Nr. 186 am Palackého-Platz.
Foto: Jiří Kühn.
Im östlichen Teil der Stadt steht das prächtige Gebäude der Grundschule U Lesa, das zwischen 1925 und 1928 für die damalige tschechische Minderheit erbaut wurde. Anlässlich der Feierlichkeiten zum 100. Jahrestag des Aufstands von Rumburk am 20. Mai 2018 wurde vor der Schule eine Büste von T. G. Masaryk enthüllt, die nach einem Entwurf des akademischen Bildhauers Josef Fojtík angefertigt wurde. Im angrenzenden Park an der Kreuzung der Husova- und Česká-Straße wurde auf Initiative der örtlichen Hussitischen Kirche eine Sandsteinskulptur von Jan Hus durch den Bildhauer Michal Drobek errichtet und am 19. Juni 2015 enthüllt.

Grundschule „U Lesa“.
Foto: Jiří Kühn.

Sandsteinskulptur von Meister Jan Hus.
Foto: Jiří Kühn.
In der Umgebung von Sporka, südwestlich des Friedensplatzes, entstand zwischen 1905 und 1912 ein Stadtpark, der heute eine wertvolle Sammlung interessanter Bäume beherbergt. Hier finden wir beispielsweise Tulpenbäume, Esskastanien, Bergahorne oder Ginkgos. Ein besonders bemerkenswerter Baum ist eine etwa 28 Meter hohe Kleinblättrige Linde, deren Alter auf 250 Jahre geschätzt wird. Im Jahr 2010 wurde auch eine 26 Meter hohe Ahornblättrige Platane, die auf dem Gelände einer Klinik für Langzeitpatienten hinter dem Bahnhof wächst und deren Alter auf etwa hundert Jahre geschätzt wird, zum Denkmalbaum erklärt. Im Garten hinter dem Haus Nr. 103 in der nordöstlichen Ecke des Míru-Platzes wurde in den 30er und 40er Jahren des 20. Jahrhunderts ein Alpinum mit einer wertvollen Gruppe von Denkmälerbäumen und Sträuchern angelegt, das seit 1994 unter Schutz steht. Es besteht aus einer Lärche, einer Stieleiche, einer Nutka-Scheinzypresse, einer Rot-Eibe und einer 18 m hohen Spitzblättrigen Magnolie.

Treppe, die zum ehemaligen alten Friedhof führt.
Foto: Jiří Kühn.
Etwa 200 m nordöstlich des Marktplatzes wurde 1786 ein Friedhof angelegt, der später erweitert wurde. Am 31. August 1909 wurde er geschlossen und als kleiner Park mit interessanten Grabsteinen von Glasmacherfamilien aus dem 18. und 19. Jahrhundert belassen. In den 70er und 80er Jahren des 20. Jahrhunderts wurde er leider zerstört, sodass heute nur noch wenige Grabsteine davon übrig sind.
Der neue Waldfriedhof wurde am östlichen Rand der Stadt an der Straße nach Radvanec angelegt. Nach einem Entwurf des Gartenarchitekten Hans Pietzner aus Breslau wurde er von der Gärtnerei Franz Stelzig aus Jablonné v Podještědí angelegt. Hinter dem Eingangstor wurde ein Haus für den Verwalter und eine Leichenhalle errichtet, die heute als Trauerhalle dient. Am 29. August 1909 wurde der Friedhof feierlich eröffnet. Der ursprüngliche Kiefernwald verwandelte sich nach und nach in einen Waldpark, in dem im Frühjahr zahlreiche Rhododendren, Azaleen und andere Ziersträucher blühen. Auf der Terrasse am Eingang des Friedhofs steht ein etwa 5 m hohes Säulenmonument für die Gefallenen des Ersten Weltkriegs, das am 22. Oktober 1922 feierlich enthüllt und 2013 restauriert wurde.

Denkmal für die Gefallenen des Ersten Weltkriegs auf dem Waldfriedhof.
Foto: Jiří Kühn.

Denkmal an den Gräbern der Teilnehmer der Rumburker Revolte. Die Nachbildung des ursprünglichen Denkmals für Karel Dvořák wurde 2015 angefertigt.
Foto: Jiří Kühn.
Am östlichen Ende des Friedhofs befinden sich die gepflegten Gräber von sieben Soldaten, die wegen ihrer Teilnahme am Aufstand von Rumburk am 29. Mai 1918 erschossen wurden. Fünf Jahre später, am 27. Mai 1923, wurde dort ein 3,5 Meter hohes Denkmal des Bildhauers Karel Dvořák feierlich enthüllt, das jedoch 1940 zerstört wurde und am 13. Juni 1948 durch einen einfachen Granitblock mit Gedenktafel ersetzt wurde. Im August 2015 wurde an seiner Stelle eine Nachbildung des ursprünglichen Denkmals enthüllt. Auch am Ort der Hinrichtung, etwas hinter dem Friedhof, wurde am 29. Mai 1938 ein kleineres Steindenkmal enthüllt, das während der nationalsozialistischen Besatzung zerstört und nach dem Krieg durch ein neues Denkmal ersetzt wurde.
Neben den Gräbern der Helden von Rumburk befindet sich ein Granitdenkmal der zweiten Widerstandsbewegung aus dem Jahr 1975, und ein weiteres Denkmal am Friedhofstor erinnert an die Opfer unter den Kriegsgefangenen und Zwangsarbeitern des Zweiten Weltkriegs. Daneben wurde am 12. August 2006 ein symbolisches Grab für mehrere deutsche Bürger errichtet, die am 2. Juni 1945 auf dem örtlichen Marktplatz erschossen wurden.

Denkmal an der Stelle der Hinrichtung hinter dem Waldfriedhof.
Foto: Jiří Kühn.

Denkmal für Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter des Zweiten Weltkriegs.
Foto: Jiří Kühn.

Symbolisches Grab der deutschen Einwohner, die am 2. Juni 1945 erschossen wurden.
Foto: Jiří Kühn.
In der Stadt sind auch mehrere Kapellen erhalten geblieben. Eine einfache Kapelle mit einer modernen Statue des Heiligen Florian in einer Nische steht auf dem Tyrš-Platz, zwischen den Häusern in Hřebence befindet sich eine verfallene Kapelle des Heiligen Alois aus dem Jahr 1876 und eine kleine Nischenkapelle aus dem 18. Jahrhundert steht ebenfalls am südlichen Rand von Nová Skalice.
Im Mai 2014 wurde in der Stadt ein etwa 5 km langer Lehrpfad „Auf den Spuren des Glashandwerks“ eingerichtet, der die interessantesten Orte von Nový Bor und Arnultovice verbindet, die mit der lokalen Glasherstellung verbunden sind.
Bedeutende Landsleute und Persönlichkeiten
In Nový Bor wurde der tschechische Nationaldichter, Sammler volkstümlicher Literatur und Übersetzer französischer, englischer und polnischer Literatur Josef Jaroslav Kalina (1816–1847) geboren, an dessen Geburtshaus in der Kalinova-Straße heute eine Gedenktafel angebracht ist. Aus einer Lehrerfamilie stammte der begabte Musiker Ludvík Slánský (1838–1905), der Professor am Prager Konservatorium wurde und ab 1870 Dirigent der Prager Deutschen Oper war.
Unter den vielen Persönlichkeiten aus der Glasindustrie, die in Nový Bor tätig waren, ist zweifellos der aus Šluknov (Schluckenau) stammende Glaswarenhändler Friedrich Egermann (1777–1864) der bekannteste, der als bedeutender Technologe und Erfinder vieler Verfahren zur Glasbearbeitung berühmt wurde, von denen das wohl bekannteste die rote Lasur ist, die er 1832 entdeckte. Aus Nový Bor stammte auch der hervorragende Glasdesigner und Maler Alexander Pfohl (1894–1953).
Sehenswürdigkeiten in der Umgebung
Im Tal der Sporka südwestlich der Stadt liegt Skalice (Langenau), über dem sich die Berge Skalický vrch (Langenauer Berg) und Chotovický vrch (Kottowitzer Berg) erheben. Am südlichen Ende schließt sich Svobodná Ves (Josefsdorf) an, deren Häuser sich am Hang des langgestreckten Bergrückens Obervald (Wolfsberg) und Češka (Tscheschkenstein) bis nach Slunečná (Sonneberg) erstrecken. In der Umgebung der Hauptstraße von Nový Bor nach Česká Lípa liegen Chotovice (Kottowitz) und die Siedlungen Janov (Johannesdorf), Bukovany (Bokwen), Chomouty (Komt) und Pihel (Pihl), in deren Nähe sich der Červený (Rotteich) und Pivovarský rybník (Brauereiteich) oder der Pihelský vrch (Pihlerberg) mit den winzigen Überresten einer Burg befinden. Südöstlich der Stadt liegt der beliebte Ferienort Sloup (Bürgstein) mit der Felsenburg und dem Freibad am Radvanecký rybník (Brettteich). Von hier aus führen mehrere Wanderwege zu den romantischen Sloupské skály (Bürgsteiner Felsen) mit der Samuelova jeskyně (Samuelshöhle), dem Cikánský důl (Zigeunergrund), dem Lesní divadlo (Waldtheater), dem Aussichtsturm Na Stráži (Wachstein), dem Psí kostel (Hundskirche) und anderen interessanten Orten. Unter den bewaldeten Gipfeln Slavíček (Slabitschken) und Tisový vrch (Eibenberg) liegt das romantische Modlivý důl (Betgraben) und Svojkov (Schwoika) mit seiner Felsenburg, nördlich unterhalb des Šišák (Schieferberg) befindet sich die Záhořínská kaple (Sohr-Kapelle). Östlich von Nový Bor liegt Radvanec (Rodowitz) mit Maxov (Maxdorf), von wo aus Wege zu den Havraní skály (Rabenfelsen) und dem bewaldeten Údolí samoty (Tal der Einsamkeit) unterhalb von Strážný (Wachberg), Hrouda (Balleberg) und Chudý vrch (Stolleberg) nach Cvikov (Zwickau) führen. Auf der Nordseite grenzt Arnultovice (Arnsdorf) an Nový Bor, über dem sich der Borský vrch (Haidaer Berg) und die Borská skalka (Hasenberg) erheben. In den Wäldern nordöstlich davon liegt der Pramenný vrch (Bornberg) und über Svor (Röhrsdorf) erhebt sich der markante Berg Klíč (Kleis) mit einem herrlichen Rundblick auf die weite Umgebung. Am Ende des Sporka-Tals oberhalb von Arnultovice liegt das malerisch gelegene Polevsko (Blottendorf) mit einem Skigebiet auf dem Polevský vrch (Blottendorfer Berg) , von dem aus eine Straße über den Pass bei Jedličná (Tanneberg) nach Kytlice (Kittlitz) führt. Westlich von Nový Bor liegt Okrouhlá (Schaiba), um das herum die Hauptstraße über Prácheň (Parchen) nach Kamenický Šenov (Steinschönau) führt. Bei Prácheň befindet sich der berühmte Panská skála (Herrenhausfelsen), der unscheinbare Aussichtspunkt Vyhlídka (Kühlberg) mit einer kleinen Skipiste, und in Richtung Polevsko erstreckt sich von hier aus der bewaldete Bergrücken Klučky (Klutschken) mit dem Obrázek (Bildstein).