Jablonné v Podještědí
(Deutsch Gabel)
Jablonné v Podještědí (Deutsch Gabel) ist eine der ältesten Städte Nordböhmens, erbaut auf einem flachen Hügel am Zusammenfluss des Panenský- (Jungfern-) und Heřmanický (Hermsdorfer) -Baches, etwa 18 km nordöstlich von Česká Lípa (Böhmisch Leipa) und 20 km westlich von Liberec (Reichenberg). Heute gehören auch die Ortschaften Česká Ves (Böhmischdorf), Heřmanice v Podještědí (Hermsdorf), Kněžice (Groß Herrndorf), Lada v Podještědí (Laaden), Lvová (Lämberg), Markvartice (Markersdorf), Petrovice (Petersdorf), Pole (Felden), Postřelná (Postrum), Valdov (Waldau) und Zámecká (Neufalkenburg) dazu, mit denen Jablonné am 1. Januar 2019 insgesamt 3622 Einwohner hatte.
Geschichte

Gesamtansicht der Stadt mit der Dominante der Kirche St. Lorenz und St. Zdislava und der ehemaligen Kirche Mariä Himmelfahrt.
Foto: Jiří Kühn.
Die Landschaft um Jablonné wurde wahrscheinlich erst um die Mitte des 13. Jahrhunderts dank der Kolonisierungstätigkeit der Markwartitzer besiedelt. Die frühesten Dörfer waren wahrscheinlich Markvartice, Česká Ves und die Siedlung Krotenful, an deren Stelle später das Schloss Neu Falkenburg errichtet wurde. Jablonné wurde um 1240 von Havel von Lemberg, dem Besitzer der Lemberger Herrschaft, gegründet und wird in historischen Quellen erstmals 1249 unter dem Namen „Gauela“ erwähnt. In einer anderen Urkunde vom 22. September 1249 wird Havel von Lemberg als „Gallus de Yablonni“ erwähnt. Ursprünglich hieß die Stadt Jablonna, später setzte sich im Deutschen der Name Gablona bzw. Gabel durch, der 1355 erstmals schriftlich erwähnt wurde. Ab 1902 wurde der Name Deutsch Gabel verwendet. Der heutige Name Jablonné v Podještědí wird seit 1946 verwendet.
Jablonné wurde erstmals 1320 als Stadt erwähnt, war aber zweifellos schon lange vorher ein Marktzentrum der Herrschaft. Bereits 1250 gab es hier eine Pfarrkirche, die 1279-1290 an das Zisterzienserkloster in Hradiště nad Jizerou (Kloster an der Iser) übergeben wurde. Eine Zeit lang gab es hier sogar eine Münzstätte, in der Brakteaten geprägt wurden. Havel und seine Frau Zdislava gründeten hier auch ein Dominikanerkloster, das erstmals 1252 erwähnt wird. Wahrscheinlich war die Stadt ab dem 13. Jahrhundert von Mauern umgeben. Irgendwann im letzten Viertel des 13. Jahrhunderts entstand dahinter die Obere Vorstadt mit der von den Zisterziensern von Mnichovo Hradiště (Münchengräz) erbauten Spitalkirche St. Wolfgang.
Im 14. Jahrhundert war Jablonné bereits eine entwickelte Stadt mit einer eigenen Selbstverwaltung. In den Jahren 1351 und 1361 verbot Karl IV. den Kaufleuten, auf anderen Wegen als über Jablonné von Böhmen in die Lausitz zu reisen, wo sie auch Zölle zu entrichten hatten. 1364 erhielten die Bürger das Recht, ihr Eigentum frei zu vererben, und vier Jahre später erlaubten ihnen die Behörden die Einrichtung von Stadtbüchern.
In den 1480er Jahren wurde die Herrschaft Lemberg geteilt und Jablonné mit Česká Ves, Heřmanice, Kněžice, Petrovice, Postřelná und Teilen von Markvartice und Křižany (Kriesdorf) wurde von Jindřich Berka von Dubá erworben, während Lemberk mit Janovice (Johnsdorf), Lückendorf, Rynoltice (Ringelshain), Žibřidice (Seifersdorf) und den anderen Teilen von Markvartice und Křižany von Hašek von Lemberk erworben wurde. Im Jahr 1402 ging der Lemberger Teil der Herrschaft in den Besitz der Vartenberger über, und im Jahr 1418 fügte Benes von Vartemberk Teile von Markvartice und Křižany sowie die Hälfte von Jablonné hinzu und teilte so die Stadt zwischen den beiden Herrschaften auf.

Blick auf die beiden Stadtkirchen von der Unteren Vorstadt aus.
Foto: Jiří Kühn.
Während der Hussitenkriege blieben die Berken von Dubá und die Wartenberger dem Kaiser Sigismund treu. So blieben ihre Güter von den Hussitenüberfällen nicht verschont. Im Jahr 1425 oder 1426 wurden Jablonné und seine Pfarrkirche niedergebrannt und das Dominikanerkloster in eine Ruine verwandelt. Viele Adlige wechselten auf die Seite der Hussiten. Jan von Vartenberk nahm 1428 die hussitische Garnison in Lemberg auf. Doch auch nach der Niederlage der Hussiten gab es keinen Frieden in der Region, denn 1439-1445 kämpften die Vartenberger mit den Lausitzer Städten.
Bereits 1435 wurde der Vartenberger Teil von Jablonné von Chval Berka von Dubá erworben. 1447 wurde die ganze Stadt wieder im Besitz von Jindřich Berka von Dubá und Lipá vereint. Auf seine Fürsprache hin gab König Georg von Poděbrady 1466 Jablonné alle Privilegien zurück, die es während der Hussitenkriege verloren hatte, und gewährte ihm außerdem einen wöchentlichen Montagsmarkt und einen jährlichen Markt am Sonntag nach dem Heiligen Johannes dem Täufer. Später, als König Georg mit einem päpstlichen Fluch belegt wurde, blieb Heinrich Berka ihm treu und verteidigte die Nordgrenze Böhmens gegen Angriffe seiner Nachbarn. Im Jahr 1467 fielen er und andere Verbündete in die Lausitz ein. Ein Jahr später schlugen die Lausitzer zurück und plünderten Lemberk, Jablonné und Ralsko. Zur gleichen Zeit verschwand wahrscheinlich auch die Festung in Jablonné, deren Existenz bereits in den 1460er Jahren belegt ist.

Blick auf den Platz vom Aussichtsturm aus.
Foto: Aleš Král.
Im Jahr 1510 soll ein Versuch unternommen worden sein, das von den Hussiten zerstörte Kloster wieder aufzubauen, doch wurde an seiner Stelle nur ein Behelfsbau aus Holz und Lehm errichtet. Zwischen 1534 und 1535 gewährte König Ferdinand der Stadt zwei weitere jährliche Märkte und drei Pferdemärkte. Ab 1558 konnte die Stadt auch freitags einen weiteren Wochenmarkt abhalten. 1565 ließen die Bürger die St. Wolfgangs-Kapelle und das Spital neu errichten, 1569 gestattete ihnen die Obrigkeit den Ausbau der Brauerei und der Mälzerei, aber sie sicherte sich das Recht, dort auch Bier für die herrschaftlichen Gasthäuser zu brauen. Im Jahr 1583 verpflichteten sich die Bürger, 200 Meißner Grosche zu zahlen, um stattdessen eine herrschaftliche Brauerei zu errichten. Die ersten Berichte über die Existenz von Zünften stammen ebenfalls aus dem 16. Jahrhundert. 1580 wurde eine Schneiderzunft erwähnt. Wahrscheinlich gab es weitere Zünfte, die erst im 17. Jahrhundert dokumentiert wurden, wie die Zunft der Bäcker und Lebküchner, Metzger, Schmiede, Weber, Schuhmacher, Strumpfwirker und Tischler. Ende des 16. Jahrhunderts erhielt die Stadt zudem ein Privileg, wonach in den umliegenden Dörfern keine Handwerker tätig sein durften, um die Interessen der städtischen Zünfte nicht zu beeinträchtigen. Zu dieser Zeit errichtete die Stadt ein neues Rathaus. 1596 wurde auch eine Schule eröffnet.

Das heute unzugängliche Schloss Neu Falkenburg ist von einem Park und Feuchtgebieten umgeben.
Foto: Jiří Kühn.
Im Jahr 1565 wurden die Herrschaft und die Stadt erneut zwischen den Brüdern Jindřich und Zdislav von Berka aufgeteilt. Der gleichnamige Sohn von Jindřich begann, seinen Besitz zu verkaufen. Die Hälfte von Jablonné wurde ihm 1599 von Markéta Hazlovská von Liběchov (Liboch) abgekauft. Sie und ihr Ehemann Vladislav Hazlovský von Hazlov (Haslau) unterdrückten die Untertanen so grausam, dass es zu zwei Aufständen kam. Die Streitigkeiten zwischen dem Adel und den Untertanen mussten von Kaiser Rudolf II. beigelegt werden,. Erst 1610, als Jablonné an Ladislav Berk von Dubá verkauft wurde, beruhigte sich die Lage. Im Jahr 1623 wurde die gesamte Herrschaft Jablonné wieder in den Händen von Jindřich Volf Berka vereint.
Während des Dreißigjährigen Krieges erlitt die Herrschaft erhebliche Schäden. Nach der Schlacht am Weißen Berg begann die Rekatholisierung Böhmens. 1623 musste der protestantische Pfarrer die Kirche in Jablonné an die Katholiken übergeben. Menschen, die nicht zum katholischen Glauben übertreten wollten, mussten ins Ausland gehen, meist ins benachbarte Sachsen. Die ganze Region wurde auch durch den Durchzug von Heeren geplagt, die mit Lebensmitteln und Getränken versorgt werden mussten. Die Stadt musste Abgaben leisten, um die Plünderungen zu verhindern. Dennoch wurde die Herrschaft beim Einfall der Sachsen 1631 und erneut 1642-1646, als die Schweden durch die Region zogen, geplündert. Nach Beendigung des Krieges im Jahr 1648 lebten nur noch 196 Familien in Jablonné, von denen fast ein Drittel neue Häuser bauen musste. Die Behörden versuchten auch, die zerstörten Güter schnell wieder aufzubauen, oft auf Kosten erhöhter Einkommensansprüche gegenüber den Leibeigenen. Die Unterdrückung durch Christoph Rudolf von Bredov, der einen kostspieligen Wiederaufbau des Schlosses unternahm, war auf der Herrschaft Lemberk berüchtigt. Als 1680 auch noch eine Pestepidemie hinzukam, brach ein Aufstand aus, der sich auf die Herrschaft Jablonné ausbreitete und mit Hilfe der Armee niedergeschlagen werden musste.
Im Jahr 1683 wurde in Jablonné mit dem Bau eines neuen Klosters begonnen. 1687 wurde auf dem Platz eine Pestsäule zur Erinnerung an die Pestepidemie errichtet. Auf die Fertigstellung des Klosters folgte 1699 der Bau der Klosterkirche St. Lorenz, die 1729 fertiggestellt und eingeweiht wurde. Zu diesem Zeitpunkt hatte Jablonné jedoch bereits andere Besitzer, denn nach dem Tod von František Antonín Berka im Jahr 1706 wurde das Anwesen von František Antonín Nostic erworben, der es zwei Jahre später an Rozália Kinská verkaufte. Von ihr kaufte es 1718 Jan Jáchym Pachta aus Rájov (Rayhofen), der bereits den benachbarten Hof Valtinov (Walten) besaß und dessen Familie bis Mitte des 19. Jahrhunderts Eigentümer des Gutes Jablonné war.

Blick auf die Kirche St. Laurentius und St. Zdislava vom Turm der ehemaligen Marienkirche.
Foto: Jiří Kühn.
Die Herstellung von Garn, Leinen- und Baumwollstoffen hat sich in der Region seit dem 17. Jahrhundert entwickelt. In der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts arbeiteten 122 Handwerker in Jablonné, darunter 40 Weber und zahlreiche Webereien, Tuchschneider, Walkmüller und Färber. In der Stadt wurden jährlich vier Märkte abgehalten, zwei Wollmärkte und drei Pferdemärkte, zwei Getreidemärkte und ein Wochenmarkt für Leinen, Flachs und Garn. Von der Bedeutung der Stadt zeugen auch die Einführung einer Kutschpost nach Zittau im Jahr 1737 und die Einrichtung einer ständigen Poststelle in Jablonné im Jahr 1751. Das Leben im 18. Jahrhundert wurde durch die österreichisch-preußischen Kriege erheblich beeinträchtigt. Jablonné litt unter den Truppeneinfällen zwischen 1744 und 1745 und wurde während des Siebenjährigen Krieges am 14. Juli 1757 von etwa 5000 preußischen Soldaten des Generals Puttkammer besetzt. Die Stadt wurde von der österreichischen Armee zwei Tage lang belagert und erst am 16. Juli nach schweren Kämpfen eingenommen. Die Kriegsereignisse betrafen vor allem die Leibeigenen. Die Missernten und Hungersnöte führten 1775 zu einem weiteren Aufstand, der fast ganz Nordostböhmen erfasste. Die Aufständischen wurden jedoch schließlich von der Armee niedergeschlagen.
Auch in schwierigen Zeiten widmeten sich die Grafen von Rájov der Modernisierung ihrer Besitzungen. Im zweiten Viertel des 18. Jahrhunderts errichteten sie ein neues Schloss in der Oberen Vorstadt. Bis 1759 verwandelten sie die im Renaissancestil erbaute Veste Neu Falkenburg in ein prächtiges Barockschloss. In den Jahren 1781-1785 wurde auch die Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt teilweise umgebaut, aber nach der Auflösung des Dominikanerklosters im Jahr 1786 wurde das Pfarrhaus in die Kirche St. Lorenz verlegt. Zwei Jahre später, am 11. Mai 1788, wütete ein Großbrand in der Stadt, der in wenigen Stunden 160 Häuser zerstörte und das ehemalige Kloster, die beiden Kirchen, das Rathaus, die Schule, die Brauerei und das Herrenhaus stark beschädigte. Auch die Klostermühle in der Vorstadt und 4 Häuser in Markvartice brannten nieder. Nur 10 Stadthäuser und die beiden Vororte konnten dank der schnellen Hilfe der Feuerwehrleute aus Mimoň (Niemes) und Zittau gerettet werden. Nach dem Brand wurde die Stadt nach und nach wieder aufgebaut und die St.-Lorenz-Kirche restauriert, während die Mariä-Entschlafenskirche ihrem Schicksal überlassen wurde.

Häuser an der südlichen Ecke des Marktplatzes mit dem Aussichtsturm im Hintergrund.
Foto: Jiří Kühn.
Während der napoleonischen Kriege im Jahr 1813 drangen Soldaten des polnischen Fürsten Poniatowski aus der Lausitz in die Nähe von Jablonné vor und am Abend des 19. August besuchte der Kaiser Napoleon mit seinem Gefolge als einzige Stadt in Böhmen Jablonné. Er hörte Vertreter der Stadtverwaltung und der Geistlichkeit in der alten Post an und kehrte dann nach Zittau zurück. Anfang September zogen sich die Truppen Napoleons von dort zurück. Bis Mitte Oktober 1813 zogen verbündete Regimenter der russischen Armee durch Jablonné, wofür die Einwohner die Versorgung mit Lebensmitteln, Futter und anderen lebensnotwendigen Dingen sicherstellen mussten. Die Kriegsschäden wurden jedoch bald behoben, und in den 1830er Jahren zählten Jablonné und seine beiden Vororte 370 Häuser und 2135 Einwohner. Die Textilproduktion lag noch in den Händen der Zunftmeister, wurde aber allmählich modernisiert. Bereits 1823 wurde eine der ersten Dampfmaschinen in Böhmen zum Antrieb der Spinnmaschinen in der Baumwollspinnerei Kittel in Markvartice eingesetzt. Zwischen 1802 und 1821 trug der Bau der Reichsstraße von Kuřívody (Hühnerwasser) über Mimoň, Jablonné und Petrovice nach Zittau zur Verbesserung des Verkehrs bei, und in den Jahren 1840-1846 wurde eine weitere wichtige Straße von Cvikov (Zwickau) nach Chrastava (Kratzau) und Liberec (Reichenberg) gebaut.
Im Zuge der Verwaltungsreform nach 1848 wurden die Gutshöfe abgeschafft. Jablonné wurde zum Verwaltungssitz des neu geschaffenen Bezirks. Im Jahr 1863 kauften die Bürger die Ruine der ehemaligen Mariä-Entschlafenskirche und bauten sie zu einer Brauerei um. 7 Jahre später wurde in der Stadt eine neue Stadt- und Bürgerschule gebaut und 1890 ein allgemeines Kreiskrankenhaus. Ende des 19. Jahrhunderts konzentrierte sich die Textilproduktion in größeren Fabriken, vor allem in den Baumwollfabriken von Ignaz Gürtler, Josef Sieber und Wenzel Rautenstrauch sowie in der Leinenweberei von Daniel Bitterlich. Wichtig war auch das Dampfsägewerk von Josef Elstner. Der Bau der Eisenbahn von Česká Lípa (Böhmisch Leipa) nach Liberec, die am 16. September 1900 eingeweiht wurde, förderte die Entwicklung der Industrie, gefolgt von der Lokalbahn von Jablonné nach Cvikov, die am 7. Oktober 1905 in Betrieb genommen wurde. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde Jablonné an das Fernstromnetz angeschlossen und 1906-1907 wurde in der Stadt ein Wasserversorgungssystem gebaut, das aus den Quellen an den Hängen des Hvozd (Hochwald) und Sokol (Falkenberg) gespeist wurde. Die Stadt verschmolz allmählich mit Česká Ves und Markvartice. 1901-1902 wurde am südlichen Stadtrand eine evangelische Kirche gebaut. Die Seligsprechung von Zdislava von Lemberk am 28. August 1907 war ein wichtiges Ereignis für die Einwohner der Stadt.

Ein prächtiges Bahnhofsgebäude aus dem Jahr 1900.
Foto: Jiří Kühn.
Während des Ersten Weltkriegs wurde auf den Feldern nördlich des Bahnhofs ein Kriegsgefangenenlager errichtet, in dem ab November 1914 hauptsächlich russische Kriegsgefangene untergebracht waren. In der Nähe der Siedlung Lada wurde ein Friedhof angelegt. Nach dem Friedensschluss zwischen Österreich und Russland am 4. März 1918 durften sich die Gefangenen in der Stadt bewegen und wurden nach dem 28. Oktober 1918 entlassen. Ende Mai 1919 waren in dem Lager über 4000 Angehörige der ukrainischen Brigade Halych interniert, die im Herbst 1921 aufgelöst wurde. Das Lager wurde anschließend abgerissen. Zu dieser Zeit gab es in Jablonné 481 Häuser mit 2732 meist deutschen Einwohnern. In der Nähe des Bahnhofs wurde eine Schule für die tschechische Minderheit eröffnet. In der Stadt gab es etwa 10 Webereien und Fabriken für die Herstellung von Leinen- und Baumwollwaren, eine Spinnerei, eine Tuchdruckerei, eine Gerberei, mehrere Heimwebereien, eine Buchdruckerei, eine Likörfabrik und eine Brauerei. Ende Juli 1929 wurde an der östlichen Ecke des Marktplatzes ein Brunnen mit einer Gedenktafel für den ehemaligen Bürgermeister Winzenz Kraus errichtet, der jedoch nach dem Zweiten Weltkrieg abgerissen wurde. Während der Wirtschaftskrise mussten die meisten Fabriken die Produktion einstellen. 1933 wurde auch die städtische Brauerei geschlossen. Wirtschaftliche Stagnation und Arbeitslosigkeit hielten bis 1934 an. Die Unzufriedenheit der Einwohner wurde von der Sudetendeutschen Partei ausgenutzt, die mit Unterstützung des faschistischen Deutschlands im Oktober 1938 die Abspaltung des tschechischen Grenzgebiets erreichte. Das Gebiet um Jablonné wurde am 3. Oktober 1938 von der deutschen Armee eingenommen, aber die anfängliche Begeisterung der Einwohner ließ mit der Zeit nach. Ein Jahr später entfesselte Deutschland den 2. Weltkrieg, und die Männer der Region zogen an die Front. Die Industrie musste auf die Kriegsproduktion umgestellt werden, und Kriegsgefangene und Angehörige der eroberten Völker mussten zur Arbeit in den Fabriken und in der Landwirtschaft eingesetzt werden. Später kamen auch Menschen aus zerbombten deutschen Städten und Flüchtlinge aus den von der vorrückenden Sowjetarmee besetzten Ostgebieten in die Stadt. Im Rahmen von Sparmaßnahmen wurden Markvartice, Česká Ves und Zámecká 1942 nach Jablonné eingemeindet.

Ein schön restauriertes Haus in der Okružní Straße.
Foto: Jiří Kühn.
Nach dem Ende des Krieges wurden die meisten deutschen Einwohner vertrieben. Neue Siedler kamen aus dem Landesinneren in die Stadt. Allerdings ließen sich nur wenige dauerhaft nieder. Während Jablonné 1930 noch 2310 Einwohner zählte, war ihre Zahl bis 1950 auf 1557 gesunken. Die Textilindustrie der Stadt verschwand praktisch. Nach der kommunistischen Machtübernahme im Februar 1948 wurden auch die privaten Gewerbebetriebe geschlossen. Das örtliche Sägewerk wurde in die Nordböhmischen Holzwerke eingegliedert und die Glasproduktion wurde in der Firma Preciosa neu aufgenommen. Anfang der 1950er Jahre wurde hier auch ein staatlicher Agrarbetrieb eingerichtet. Die Stadt entwickelte sich zu dieser Zeit nicht weiter. Erst 1965 wurde an ihrem nördlichen Rand ein neues Naturbad mit Autocamp, Hütten und einem Restaurant eröffnet. Nach 1970 wurde mit dem Bau von Wohnungen begonnen und 3 Jahre später wurde eine neue Grundschule eröffnet. Im Jahr 1973 wurde der Personenverkehr auf der Bahnstrecke von Jablonné nach Svor (Röhrsdorf) eingestellt. Die Güterzüge nach Cvikov fuhren jedoch noch bis Mai 1986, als die Strecke endgültig stillgelegt wurde. Die umliegenden Dörfer wurden nach und nach entvölkert. Am 1. Januar 1981 wurden Heřmanice, Janovice, Kněžice, Lada, Lvová, Petrovice, Postřelná und Velký Valtinov (Groß Walten) nach Jablonné eingemeindet. Nach der politischen Wende im November 1989 wurden Janovice v Podještědí und Velký Valtinov jedoch ab dem 1. Januar 1991 wieder unabhängig.
Die Dominikaner kehrten in das Kloster in Jablonné zurück. Am 21. Mai 1995 sprach Papst Johannes Paul II. die selige Zdislava von Lemberk in Olomouc (Olmütz) heilig. Eine Woche später wurde die Heiligsprechung von Zdislava in Jablonné gefeiert. Am 10. August 1996 wurde die örtliche Kirche zur Basilika Minor des Heiligen Laurentius und der Heiligen Zdislava erhoben. Die ehemalige Liebfrauenkirche wurde nach 2000 teilweise rekonstruiert. Am 21. November 2002 wurde ein Aussichtsturm eingeweiht. In den Jahren 2017-2019 wurden der Platz und die angrenzenden Straßen im historischen Zentrum der Stadt rekonstruiert.
Denkmäler und Merkwürdigkeiten

Die Fassade der St.-Lorenz- und St.-Zdislava-Kirche.
Foto: Jiří Kühn.
Seit 1992 steht Jablonné unter Denkmalschutz, dessen wichtigstes Wahrzeichen die Kirche St. Lorenz und St. Zdislava ist. An ihrer Stelle befand sich einst eine gotische Kirche, die 1252 erstmals erwähnt und zusammen mit dem angrenzenden Kloster vom Gutsbesitzer Havel von Lemberk und seiner Frau Zdislava gegründet wurde. Die heutige Barockkirche wurde zwischen 1699 und 1722 nach einem Entwurf des Wiener Architekten Johann Lucas von Hildebrandt erbaut. Finanziert wurde der Bau vom Gutsbesitzer František Antonín Berka von Dubá. Der Grundstein wurde am 18. September 1699 gelegt. Die alte Kirche wurde jedoch im darauffolgenden Jahr abgerissen. 1702 wurden die sterblichen Überreste von Zdislava aus dem Grab unter der Kirche in einen Sarg gelegt und in den Kreuzgang des Klosters überführt. Für den Bau der neuen Kirche musste das Gelände am Hang hinter der Stadtmauer durch einen Damm erweitert werden, und neben Zdislavas ursprünglicher Krypta wurden unterirdisch drei Stockwerke mit Katakomben gebaut, die bis zu 39 Meter tief reichen. In den ersten Jahren wurde der Bau von dem aus Litoměřice (Leitmeritz) stammenden Baumeister Pietro Bianco geleitet. Nach dem Tod von František Antonín Berka am 25. März 1706 begann sich der Bau aufgrund fehlender Mittel zu verzögern und das ursprüngliche Projekt musste geändert werden. Im Jahr 1708 übernahm der Italiener Domenico Perini die Leitung des Baus, der das Projekt etwas veränderte und die Struktur der Kuppel vereinfachte. Unter den Lehnsherren von Rájov ging der Bau nach 1718 langsamer voran, so dass die Kirche erst am 4. August 1729 eingeweiht wurde. Zwei Jahre später wurden die sterblichen Überreste von Zdislava von Lemberk in die Krypta unter der Kirche umgebettet. Die Arbeiten an der Innenausstattung dauerten bis 1769. Nach der Aufhebung des Dominikanerklosters im Jahr 1786 wurde die Kirche zur Pfarrkirche. Zwei Jahre später wurde sie durch einen großen Stadtbrand schwer beschädigt, aber in den folgenden Jahren wurde sie wieder instand gesetzt. Am 10. August 1996 wurde die Kirche zur Basilika Minor des Heiligen Laurentius und der Heiligen Zdislava erhoben.

Seitenansicht der St.-Lorenz- und St.-Zdislava-Kirche.
Foto: Jiří Kühn.
Der rechteckige Barockbau hat einen Innengrundriss in Form eines langgestreckten Kreuzes, bestehend aus einem quadratischen Mittelschiff mit abgeschrägten Ecken, in das an vier Seiten die elliptischen Räume von zwei Seitenkapellen, einem Chor und einem Presbyterium mit angrenzender Apsis eindringen. In den abgeschrägten Ecken des Kirchenschiffs befinden sich massive Bogenpfeiler, die die obere Kuppel mit einer Laterne tragen, in die kleinere rechteckige Kapellen mit niedrigen Emporen eingefügt sind, die von zwei ionischen Säulen getragen werden. Der barocke, mit Kragsteinen versehene Chor ruht ebenfalls auf zwei Säulen, und alle Seitenräume der Kirche sind durch Seitengänge miteinander verbunden.
Die Außenfassade der Kirche mit drei Portalen und zwei Prismentürmen ist reich mit Skulpturen von Johann Franz Bienert aus dem Jahr 1711 geschmückt. Im mittleren Teil, der leicht in den Vordergrund ragt, befinden sich ein halbrundes Fenster aus dem Jahr 1713 und vier Nischen mit Sandsteinstatuen der Schutzpatrone des Dominikanerordens. In den unteren Nischen befinden sich der Heilige Laurentius und die Heilige Zdislava von Lemberg, darüber der Ordensgründer, der Heilige Dominikus, und der Heilige Thomas von Aquin. Auf der Balustrade des Dachgeschosses befinden sich Statuen des heiligen Prokop, des heiligen Johannes des Täufers, der Jungfrau Maria, des heiligen Adalbert, des heiligen Johannes von Nepomuk und zwei leere Sockel, auf denen wahrscheinlich die Statuen des heiligen Wenzel und des heiligen Josef stehen sollten.

Das Innere der Kirche St. Lorenz und St. Zdislava.
Foto: Jiří Kühn.
Die reiche Innenausstattung der Kirche stammt größtenteils aus der Zeit nach dem Stadtbrand von 1788. Der pseudobarocke Hauptaltar wurde 1899 von Wilhelm August geschaffen, das Altarbild des heiligen Laurentius wurde ein Jahr später von Karel Krattner gemalt und das kleine Porträt der heiligen Zdislava von Prof. Mervart stammt aus dem Jahr 1973. Über dem Eingang vom Presbyterium in die Sakristei befindet sich eine künstlerisch wertvolle Marmorbüste des Kirchengründers František Antonín Berka, ein italienisches Werk aus der Zeit um 1700, und gegenüber eine Büste seiner Schwester Rosalie Kinsky von J. F. Bienert aus dem Jahr 1711.
Im Kirchenschiff befinden sich sechs Seitenaltäre. In der kleineren Kapelle rechts vom Presbyterium befindet sich ein barocker Altar des Heiligen Kreuzes aus dem Jahr 1718 mit einer Pieta-Statue aus dem Jahr 1881 und einem kleinen Gemälde des seligen Karl von Habsburg darunter. Auf der rechten Seite des Kirchenschiffs befindet sich der barocke Altar Unserer Lieben Frau vom Rosenkranz aus dem Jahr 1732 mit Statuen der Jungfrau Maria, des heiligen Dominikus, des heiligen Thomas von Aquin, des heiligen Albert des Großen, Gottvaters und Engeln. In der rechten hinteren Kapelle befindet sich der barocke Altar des heiligen Josef mit einem Bild des heiligen Johannes von Nepomuk und Statuen des heiligen Josef und des heiligen David aus den 1820er Jahren.
Auf der linken Seite des Presbyteriums befindet sich eine klassizistische Kanzel mit einer Büste des Heiligen Petrus, die 1792 vom örtlichen Bildhauer Josef Neumann geschaffen wurde. In der kleineren Kapelle daneben steht ein Rokoko-Altar der Heiligen Anna mit Statuen aus dem Jahr 1886 und einem Gemälde des Heiligen Vinzenz Ferrer aus dem Jahr 1764. Auf der linken Seite des Kirchenschiffs befindet sich ein pseudobarocker Herz-Jesu-Altar aus dem Jahr 1911 mit barocken Statuen der Heiligen Petrus und Paulus. Der Rokoko-Altar der Jungfrau Maria in der linken hinteren Kapelle aus der Zeit um 1770 wird besonders verehrt. In der Nische dieses Altars befindet sich eine spätgotische Holzstatue der Madonna aus der Zeit um 1530, die aus der alten Pfarrkirche stammt, und darunter in einem verglasten und vergoldeten Reliquienschrein von 1908 der Schädel der heiligen Zdislava. Über dem Altar befindet sich ein Gemälde der Heiligen Therese aus dem Jahr 1853, an den Seiten stehen Statuen der Heiligen Katharina von Siena und der Heiligen Susa. Im Fußboden vor dem Altar ist ein Blick in die Krypta der Heiligen Zdislava möglich, die von einem barocken schmiedeeisernen Gitter aus dem Jahr 1732 umschlossen ist.
In der Kirche befinden sich auch klassizistische Beichtstühle aus dem Ende des 18. Jahrhunderts und ein mit Zinn-Engeln verziertes Rokoko-Taufbecken aus dem Jahr 1764, das aus der früheren Pfarrkirche hierher gebracht wurde. Die mit Intarsien verzierten Rokoko-Chorbänke stammen aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Die Orgel im Chor wurde 1895 von dem Prager Organisten Heinrich Schiffner gebaut. Ihr pseudobarockes Gehäuse ist mit Engelsskulpturen verziert, die von einem früheren Instrument aus dem Jahr 1772 stammen. An den Wänden unterhalb der Kuppel befinden sich Hell-Dunkel-Gemälde der Heiligen Zdislava und der vier Evangelisten aus dem Jahr 1852 von Karel Krattner aus Prag.

Der Hauptaltar in der Kirche St. Laurentius und St. Stanislaus.
Foto: Jiří Kühn.

Der Altar der Jungfrau Maria mit dem Reliquienschrein der heiligen Zdislava.
Foto: Jiří Kühn.

Die Statue des Heiligen Vinzenz Ferrer neben der Kirche des Heiligen Laurentius und der Heiligen Zdislava.
Foto: Jiří Kühn.
Im Untergrund der Kirche befinden sich ausgedehnte Katakomben, von denen heute nur die Krypta mit dem Grab der Heiligen Zdislava von Lemberk öffentlich zugänglich ist. An ihren Wänden befinden sich 24 kupfergemalte Bilder mit Szenen aus der Legende der Heiligen Zdislava, die im Jahr 1660 nach älteren gestochenen Vorlagen angefertigt wurden. In den anderen Gruften wurden Dominikanermönche, der Grundherr Berka von Dubá und der Grundbesitzer von Rájov aus dem 18. Jahrhundert, die Leichen von drei beim Bau der Kirche verstorbenen Arbeitern und ein kleiner Sarg eines Kesselflickers beigesetzt - ein Junge, der wahrscheinlich aus Neugierde hier hineinging und nicht mehr herauskam.
In dem umzäunten Garten neben der Kirche steht eine Sandsteinstatue des Dominikanerheiligen St. Vincent Ferrer mit einer kleinen Puttenfigur aus der Zeit vor 1770. Die Statue hat einen reich verzierten Sockel mit einem Gesims, an dessen Rändern sich einst zwei Engelsfiguren befanden. Auf der Rückseite des Sockels stehen die Renovierungsdaten 1835, 1888 und 1927.

Das Gebäude des Dominikanerklosters neben der Kirche des heiligen Laurentius und der heiligen Zdislava.
Foto: Jiří Kühn.
An der Nordostseite der Kirche befindet sich das Dominikanerkloster, das erstmals in einer Urkunde aus dem Jahr 1252 schriftlich erwähnt wird, in der allen, die zum Bau des Klosters beitrugen, ein Ablass gewährt wurde. Das Klostergebäude, das wahrscheinlich um 1269 fertiggestellt wurde, wurde 1425 von den Hussiten zerstört. Die Dominikaner flohen daraufhin, kehrten aber bald wieder zurück und erhielten 1430 von Jarek von Pecka Gelder für Reparaturen. Erst 1510 wurde ein neues, bescheidenes Klostergebäude aus Holz und Lehm an der Stelle der ursprünglichen Gebäude errichtet.
Im Jahr 1683 begannen die Dominikaner mit einem umfassenden Umbau des Klosters, den der damalige Besitzer von Jablonné, František Antonín Berka von Dubá, mit Hilfe des Barons Putz und der Gräfin Hartig von Mimon sowie des Grafen Breda von Lemberk initiierte. Die ursprünglichen Gebäude wurden nach und nach abgerissen und an ihrer Stelle wurde unter der Leitung des Baumeisters Pietro Bianco aus Litoměřice ein neues Barockkloster errichtet, das im Jahr 1696 in Rohbauweise fertiggestellt wurde, dessen geringfügige Änderungen jedoch bis 1700 andauerten. Nach der Aufhebung des Klosters durch das Dekret von Kaiser Joseph II. vom 24. August 1786 wurde ein Teil des Klosters zum Pfarrhaus und der andere Teil ging in den Besitz der Stadt über. Im städtischen Teil des Klosters wurde 1926 ein Museum eingerichtet, das 1945 in die ehemalige Brauerei umzog. Schon 4 Jahre später wurde es geschlossen und seine Sammlungen 1963 in das Bezirksmuseum für Heimatkunde in Česká Lípa überführt.
Nach dem Zweiten Weltkrieg kehrten die Dominikaner nach Jablonné zurück. Nach der kommunistischen Machtübernahme wurde das Kloster in der Nacht des 4. Mai 1950 gewaltsam beschlagnahmt und die Mönche wurden im Sammelkloster in Broumov (Braunau) interniert. Auch nach der Normalisierung der Verhältnisse im Jahr 1969 lebten sie kurzzeitig in Jablonné. Erst nach der Samtenen Revolution durften sie 1990 endgültig zurückkehren.
Das Kloster besteht aus einem einfachen vierflügeligen Gebäude mit einem geschlossenen Klosterhof, der von einem kreuzverglasten Kreuzgang umgeben ist, der sich heute durch verglaste Rundbogenarkaden in den Hof öffnet. Das Eingangsportal des Klosters befindet sich neben dem linken Seiteneingang zur Kirche und ist mit einem Sandsteinwappen aus dem Jahr 1722 verziert.

Das ehemalige Herrenhaus am Dominikanerplatz.
Foto: Jiří Kühn.
Auf dem parkähnlich angelegten Dominikanerplatz vor der St.-Lorenz- und St.-Zdislava-Kirche steht das Gebäude des ehemaligen Herrenhauses, welches Sitz der Oberbehörde war und nach 1848 verschiedene Staatsämter beherbergte. Das heutige Aussehen des Hauses stammt aus dem Jahr 1897. An der Südseite des Platzes stehen die barocken Sandsteinstatuen des heiligen Johannes von Nepomuk und der heiligen Zdislava aus dem Jahr 1709, die auf massiven Sockeln mit den geprägten Wappen der Berken von Dubá stehen, die sie anfertigen ließen. Die Statuen standen ursprünglich am Ufer des Schlossteichs, von wo aus sie vorübergehend in die St.-Lorenz-Basilika gebracht wurden. Ende 1987 wurde beschlossen, sie nach Nové Falkenburg zu bringen. Wegen der hohen Luftfeuchtigkeit wurden sie jedoch 1994 von dort wieder an ihren heutigen Standort gebracht.

Die Statue des hl. Johannes von Nepomuk auf dem Dominikanerplatz..
Foto: Jiří Kühn.

Die Statue der Heiligen Zdislava auf dem Dominikanerplatz.
Foto: Jiří Kühn.

Die ehemalige Kirche der Mariä Himmelfahrt.
Foto: Jiří Kühn.
Ein weiteres bedeutendes Kirchengebäude war die ursprüngliche romanisch-gotische Pfarrkirche des Heiligen Kreuzes, die um die Mitte des 13. Jahrhunderts erbaut und erstmals 1279-1290 urkundlich erwähnt wurde, als Zdislav von Lemberk den Zisterziensern von Mnichovohradiště (Münchengrätz) das Patronatsrecht über die Kirche übertrug. Während der Hussitenkriege im Jahr 1425 wurde die Kirche schwer beschädigt und nach der Reparatur am 8. September 1457 zu Ehren der Himmelfahrt der Jungfrau Maria neu geweiht. Es heißt, dass die Kirche fünf Altäre mit Heiligenstatuen, 22 große Gemälde, eine Orgel und sechs Glocken besaß. Die Kirche wurde restauriert, nachdem ein Blitzschlag am 24. Juni 1758 das Dach, die Innendecke, die Orgel und andere Einrichtungsgegenstände zerstört hatte. Ein größerer Umbau fand in den Jahren 1781-1785 unter den Grafen von Rájov statt, als der ursprüngliche achteckige Glockenturm an der Ostseite der Kirche abgetragen wurde und der Baumeister Filip Heger einen Teil des Kirchenschiffs umbaute und eine neue spätbarocke Westfassade mit einem Turm errichtete. Da die Kirche nur teilweise umgebaut wurde, wurde das Pfarrhaus nach der Auflösung des Dominikanerklosters im Jahr 1786 in die größere Kirche St. Lorenz verlegt, die durch Gerichtsbeschluss vom 21. März 1786 zur Pfarrkirche wurde. Beim Stadtbrand am 11. Mai 1788 brannte die Marienkirche nieder und wurde nicht wieder aufgebaut, da sie nicht mehr benötigt wurde. Im Januar 1863 wurde die Ruine von bürgerlich-konservativen Bürgern gekauft und zu einer Brauerei umgebaut, in der bis 1933 Bier gebraut wurde. Nach dem Zweiten Weltkrieg zog kurzzeitig das Stadtmuseum hier ein, bis 1973 war es eine Schule und in den folgenden Jahren verfiel das Gebäude. Nach dem Jahr 2000 rekonstruierte die Stadt den 32 m hohen Kirchturm. Am 20. November 2002 wurde auf seiner neu überdachten Galerie ein Aussichtspunkt eröffnet, von dem aus man einen schönen Blick auf das Stadtzentrum und die umliegende Landschaft hat, die im Süden von den markanten Gipfeln Ralsko (Roll) und Tlustec (Tolzberg), im Norden vom Lausitzer Gebirge mit Klíč (Kleis), Zelený (Grün-) und Jezevčí vrch (Limberg), Luž (Lausche), Hvozd, Sokol und im Westen vom Ještěd (Jeschken)-Kamm flankiert wird.

Die Kirche Mariä Himmelfahrt wurde in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu einer Brauerei umgebaut. Heute befindet sich auf dem restaurierten Turm ein Aussichtsturm.
Foto: Jiří Kühn.
Die Liebfrauenkirche war für ihre Zeit ungewöhnlich groß, ihr Kirchenschiff maß 24,4 x 16,5 Meter und ihre Höhe überstieg 10 Meter. Heute sind nur noch die Außenmauern mit schmalen romanischen Fenstern und das frühgotische Portal des Seiteneingangs mit gebrochenem Bogen an der Südfassade erhalten. Auch der leicht gebrochene Triumphbogen, der das Kirchenschiff mit dem Altarraum verbindet, der abgerissen und durch einen Neubau mit Brauereikellern ersetzt wurde, ist erhalten. An der Westseite der Kirche befindet sich eine geschwungene Barockfassade mit einem Steinportal und einem massiven quadratischen Turm mit einer überdachten Steinempore. Es existiert eine alte Geschichte über die Kirchenglocken.
Um die Kirche herum befand sich früher ein Friedhof, der nach dem Brand der Stadt geschlossen wurde. In dem Rest der Mauer wurde im 18. Jahrhundert eine Barockkapelle eingebaut. Von der Stadtmauer, die vielleicht schon im 13. Jahrhundert errichtet wurde, sind heute nur noch kleine Reste an der Nordwest- und Südseite erhalten. Im Hof des Hauses Nr. 79 am südwestlichen Stadtrand hat sich ein 2,5 m hoher Mauerrest mit einer Galerie erhalten, die an der Basis etwa 1,5 m breit ist. An der Südseite der Stadt befand sich früher das Untere oder Prager Tor, das 1837 abgerissen wurde. Im folgenden Jahr wurde das Obere Tor in der heutigen Zdislava z Lemberka-Straße abgerissen.
In der Nähe der ehemaligen Marienkirche steht das Gebäude der Bürgerschule aus dem Jahr 1870, das bis zur Fertigstellung der neuen Schule im Jahr 1972 für den Unterricht genutzt wurde. Auf der gegenüberliegenden Seite der Školní-Straße steht das zweistöckige alte Pfarrhaus Nr. 12, das in den Jahren 1995-1997 zum Sitz der Verwaltung des Landschaftsschutzgebiets Lausitzer Gebirge umgebaut wurde.

Die ehemalige Bürgerschule aus dem Jahr 1870.
Foto: Jiří Kühn.

Das alte Pfarrhaus beherbergt heute die Verwaltung des Landschaftsschutzgebietes Lužické hory.
Foto: Jiří Kühn.

Barocke Pestsäule von Christus dem Erlöser in der Mitte des Marktplatzes.
Foto: Jiří Kühn.
Der Hauptplatz wird von der frühbarocken Pestsäule Christi des Erlösers beherrscht, die 1687 als Dank für die Abwendung der Pestepidemie von 1680 errichtet wurde. Die reich verzierte Sandsteinsäule ist von einer quadratischen Balustrade umgeben, in deren Ecken sich die Statuen des Heiligen Johannes des Täufers, des Heiligen Laurentius, des Heiligen Florian und des Heiligen Johannes von Nepomuk befinden, die der Bildhauerwerkstatt von Jelinek von Kosmonosy (Kosmanos) zugeschrieben und wahrscheinlich in den 1820er Jahren hinzugefügt wurden. In der Mitte der Vorder- und Rückwand der Balustrade befinden sich zwei Engel mit Kartuschen und an den Seiten ein Paar Steinvasen. Zwischen den Engeln befinden sich Metalltore, die zu einem mit Sandsteinplatten gepflasterten Innenraum führen. In seiner Mitte steht auf drei Steinstufen ein großer Sockel, dessen unterer Teil mit den Statuen des Heiligen Joachim, des Heiligen Adalbert, des Heiligen Vinzenz von Ferrer und der Heiligen Anna, ebenfalls aus den 1820er Jahren, und dessen oberer Teil mit den Statuen des Heiligen Josef, der Heiligen Rosalie von Lima, des Heiligen Sebastian und des Heiligen Wenzel aus dem Jahr 1687 geschmückt ist. Auf der erhöhten Konsole zwischen dem Heiligen Josef und dem Heiligen Wenzel befindet sich eine Marienstatue. Inschriften an der Vorder- und Rückwand des Sockels erinnern an die Entstehung der Säule, während Inschriften an den Seiten über die Renovierungen in den Jahren 1882 und 1927 informieren. Auf dem Sockel steht die Säule selbst mit einem reich verzierten korinthischen Kopf und einer Statue von Christus, dem Erlöser, dem Sieger über den Tod.
An der Westseite des Platzes steht das interessante zweigeschossige klassizistische Bürgerhaus „U Salvátora“ Nr. 161 mit Mansarddach, dessen heutiges Aussehen das Ergebnis eines Wiederaufbaus nach einem Brand im Jahr 1788 und späterer kleinerer Veränderungen ist. Die Fassade mit reicher Stuckverzierung aus den 1920er Jahren hat ein steinernes Eingangsportal mit Ziergirlanden und der Aufschrift JK Nr. 162 am Hauptbogen. Auf der gegenüberliegenden Seite des Platzes stehen das eher unscheinbare Rathausgebäude Nr. 22 und ein Informationszentrum im Nachbargebäude.

Häuser mit dem Rathaus an der Südostseite des Platzes.
Foto: Jiří Kühn.

Historisches Stadthaus „U Salvátora“ auf dem Platz (links).
Foto: Jiří Kühn.

Das zweigeschossige Stadthaus Nr. 147 mit Volutengiebel.
Foto: Jiří Kühn.
In den angrenzenden Straßen finden wir eine Reihe von Stein- und Fachwerkhäusern, von denen einige unter Denkmalschutz stehen. In der Nähe der St.-Lorenz-Kirche in der Školní-Straße steht das überwiegend aus Fachwerk bestehende Haus Nr. 31 aus der Wende des 18. und 19. Jahrhunderts mit einem teilweise aus Fachwerk bestehenden Fußboden und einem Satteldach mit durchgehender schlesischer Gaube. Gegenüber der Kirche befindet sich das denkmalgeschützte zweigeschossige Backsteinhaus Nr. 147 mit Volutengiebel, das vor 1843 erbaut wurde. Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts hat es eine neobarocke Fassade mit reicher Stuckverzierung und über dem Hauptportal einen Zierbogen mit der Nr. 147 und der Skulptur eines liegenden Löwen, an den Seiten Reliefs des Apothekerstabs von Martha mit einer gewundenen Schlange. Am Ende der Straße Karolíny Světlé steht das interessante zweigeschossige Haus Nr. 104 aus dem frühen 19. Jahrhundert mit schieferverkleideten Giebeln, dessen skulpturale Fassade mit Stuckdekoration im Stil des späten geometrischen Jugendstils verziert ist. Gegenüber an der Ecke zur Staroměstská-Straße befindet sich das zweistöckige Fachwerkhaus Nr. 93 mit unvollständigem Umgebinde aus der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert. Im rechten Winkel dazu steht eine Wohnscheune mit Fachwerkboden und Holzveranda.

Das denkmalgeschützte Fachwerkhaus Nr. 31 in der Nähe der St.-Lorenz-Kirche.
Foto: Jiří Kühn.

Das zweigeschossige Fachwerkhaus Nr. 93 an der Ecke der Staroměstská Straße.
Foto: Jiří Kühn.

Schloss der Grafen von Rájov mit der barocken Säule der Heiligen Dreifaltigkeit.
Foto: Jiří Kühn.
Auf der rechten Seite der Hauptstraße Zdislava z Lemberka, etwa 350 m vom Marktplatz entfernt, steht das Schloss der Familie Pachta aus Rájov, das im zweiten Viertel des 18. Jahrhunderts von František Josef Pachta als Wohnsitz des gräflichen Oberförsters errichtet wurde. Es handelt sich um einen zweistöckigen Rokokobau mit einem Dreiecksgiebel, einem ovalen Balkon und einem Mansarddach mit zwei Gauben, flankiert von zwei Rundbogenportalen. Seit dem 17. Juli 1737 war es die Station der Kavalleriepost von Jablonné nach Zittau und später das Postamt, das 1897 in das Amtsgebäude auf den Dominikanerplatz verlegt wurde. Danach waren hier das Bezirkspfandhaus und die Gendarmerie untergebracht, nach 1948 wurde das Gebäude als Kindergarten und Hort für Kinder genutzt. Heute beherbergt das Schloss ein Café und ist gelegentlich Austragungsort verschiedener kultureller und gesellschaftlicher Veranstaltungen.
Das Schloss wurde in der Vergangenheit von mehreren prominenten Persönlichkeiten besucht, darunter Herzog Friedrich Wilhelm von Braunschweig-Lüneburg, Napoleons Marschall Fürst Joseph Anton Poniatowski und der Oberst der Panduren, Franz Baron Trenck, der hier sein Hauptquartier aufschlug. An die bedeutenderen Besuche erinnern zwei Gedenktafeln, die der Oberrichter Adolf Klein dort angebracht hat. In der flachen Nische auf der linken Seite des Schlosses befand sich eine Marmortafel vom 28. November 1880, die an den Aufenthalt von Kaiser Joseph II. vom 17. bis 18. September 1779 erinnerte. Eine Tafel von 1891 auf der rechten Seite machte auf den kurzen Besuch Napoleons am 19. August 1813 aufmerksam. Beide Tafeln wurden jedoch 1924 entfernt. Heute erinnern neue Tafeln an der linken Seite des Gebäudes an die Geschichte des Schlosses und den Aufenthalt Napoleons in Jablonné.
An der rechten Ecke des Schlosses steht eine frühbarocke Sandsteinsäule mit einer Darstellung der Heiligen Dreifaltigkeit aus dem frühen 19. Jahrhundert. Sie wurde vermutlich von Johann Ferdinand Feuereisen errichtet, der von 1823 bis 1852 Postmeister in der Gemeinde war. Auf dem reich gegliederten Sockel befindet sich ein Relief, das wahrscheinlich den Erzengel Raphael und Tobias darstellt, mit den Köpfen von Engeln an den Seiten und zwei Steinvasen im Hintergrund. Auf einer 4 m hohen Mosaiksäule mit Kopf befindet sich eine Statue von Gottvater, der mit einer Weltkugel auf dem Schoß und einer Taube des Heiligen Geistes sitzt.

St.-Wolfgang-Kapelle.
Foto: Jiří Kühn.
Etwa 50 m weiter befindet sich die schlichte St.-Wolfgang-Kapelle, die zu den ältesten Bauwerken der Stadt zählt und noch ihren frühgotischen Kern aus dem 13. Jahrhundert bewahrt hat. Erbaut wurde die Kapelle zwischen 1279 und 1290 von Zisterziensermönchen aus Mnichovo Hradiště, die auch das benachbarte Hospital und die Pfarrkirche Zum hl. Kreuz verwalteten. Nach der Zerstörung durch die Hussiten im Jahr 1425 ging die Kapelle in den Besitz der Stadt über und wurde 1565 von Jindřich Berka von Dubá im Renaissancestil wiederaufgebaut und mit Sgraffito verziert. Während der Herrschaft der Pachtas von Rájov um 1760 wurde in einer flachen Nische über dem Eingang eine Kartusche mit dem Stadtwappen angebracht und das Renaissance-Sgraffito mit Gips überdeckt. Zur gleichen Zeit ist auch die Widmung der Kapelle dem heiligen Wolfgang erstmals dokumentiert. 1850 wurde am Türmchen der Kapelle ein Kreuz aus dem abgerissenen Oberen Tor angebracht und 6 Jahre später der 1602 erstmals erwähnte Spitalfriedhof aufgelöst. 1913 wurde vom Besitzer des Kunstinstituts in Nový Bor (Haida), Heinrich Hess, geboren in Jablonné, ein neues bemaltes Fenster mit dem Motiv „Lasst die Kindlein zu mir kommen“ erworben. Das Äußere der Kapelle wurde 1923 restauriert, als ein weiteres farbiges Fenster mit dem Motiv der Geburt Christi erworben wurde. Die Renaissance-Sgraffitofassade wurde 1961 restauriert. Nach 1969 wurde die Kapelle nach dem Entwurf des Architekten Jiří Škabrady zu einer Trauerhalle umgebaut.
Die quadratische Kapelle mit einem polygonal geschlossenen Presbyterium ist in das benachbarte Krankenhausgebäude integriert, das bis 1945 in Betrieb war. Auf dem Dach befindet sich ein achteckiges kleines Glockentürmchen, das von einer Halbkuppel mit Kreuzabschluss bedeckt ist. In der Mitte der Hauptfassade mit Sgraffitoverzierung befindet sich ein steinernes Eingangsportal mit dem Sandsteinwappen der Stadt und zwei halbrunden Fenstern an den Seiten. An der Ost- und Südwand befinden sich Spitzbogenfenster des Presbyteriums, das gleiche Fenster befindet sich an der Südostseite des Kirchenschiffs.
Gegenüber der Kapelle befindet sich der ummauerte Stadtfriedhof mit einer Leichenhalle, an deren linker Seite ein massives prismatisches Denkmal für die Gefallenen des Ersten Weltkriegs mit Reliefdekoration und Tafeln mit 69 Namen der Gefallenen steht, entworfen von Wilhelm Schwarzbach aus Svor. Etwa 250 m weiter in Richtung Liberec steht im Garten des Hauses Nr. 143 im Kataster von Markvartice eine barocke Statue des heiligen Johannes von Nepomuk aus dem Jahr 1733. An der Kreuzung der Straßen nach Lvová und Petrovice steht eine barocke Marterlsäule vom Ende des 17. Jahrhunderts mit einer Gipfelkapelle, die mit Bildern des hl. Dominikus, des hl. Laurentius, des hl. Petrus und der hl. Zdislava geschmückt ist.

Der Stadtfriedhof mit der Leichenhalle und dem Denkmal für die Gefallenen des Ersten Weltkriegs (links).
Foto: Jiří Kühn.

Die Marterlsäule an der Kreuzung der Straßen nach Lvová und Petrovice.
Foto: Jiří Kühn.

Elstners Villa am südwestlichen Rand der Stadt.
Foto: Jiří Kühn.
Am südwestlichen Rand der Stadt, an der Straße nach Cvikov, steht die beeindruckende Villa von Josef Elstner, die Motive der Spätgotik und der deutschen Renaissance vereint, ergänzt durch Fachwerkwände in den oberen Stockwerken und eine Loggia an der Seite des Turms. Das 1904 erbaute Haus wurde als Villa Harmonie in dem Film „Familiäre Turbulenzen des Beamten Tříska“ berühmt.
Auf der rechten Seite der Lidická-Straße, die aus der Stadt in Richtung Mimon führt, steht beim Haus Nr. 239 eine barocke Sandsteinstatue der Jungfrau Maria aus dem zweiten Viertel des 18. Jahrhunderts, deren Sockel mit einem Relief des heiligen Josef verziert ist. An der Grenze zwischen der Stadt und Česká Ves, auf einer kleinen Anhöhe zwischen der Lidická- und der Valtinovská-Straße, steht die neugotische evangelische Kreuzkirche, deren Grundstein am 22. September 1901 gelegt und am 21. Juli 1902 eingeweiht wurde. Nach 1945 wurde sie von der evangelischen und der tschechoslowakisch-hussitischen Kirche genutzt, später stand sie jedoch leer und verfiel. Jiřina Klásková, Pfarrerin der Hussitenkirche aus Hrádek nad Nisou (Grottau), setzte sich für die Rettung der Kirche ein, dank derer sie mit Hilfe des Bezirksnationalausschusses in Česká Lípa repariert und am 4. Oktober 1986 wieder eingeweiht werden konnte. Das einschiffige, rechteckige Gebäude mit Chor und Sakristei ist aufgrund der Form des Hügels nicht ausgerichtet. An der südöstlichen Seite befindet sich ein polygonales Presbyterium mit zwei pseudogotischen Buntglasfenstern, die den Apostel Paulus und Johannes den Täufer darstellen.

Evangelische Kirche am Stadtrand bei Česká Ves.
Foto: Jiří Kühn.

Die Statue der Jungfrau Maria beim Haus Nr. 239.
Foto: Jiří Kühn.

Das Gebäude des ehemaligen Schießstandes in der Tyršova Straße.
Foto: Jiří Kühn.
In der Tyršova-Straße, südöstlich der ehemaligen Frauenkirche, befindet sich ein zweistöckiges Krankenhausgebäude aus dem Jahr 1902, das durch spätere Umbauten erheblich verändert wurde, und 100 m weiter das beeindruckende Gebäude des Schießstandes mit zwei Türmen an den Seiten der Hauptfassade, das von Anton Posselt nach dem Plan des Architekten Wenzel Bürger errichtet wurde. Mit dem Bau wurde am 17. August 1901 begonnen und nach seiner Fertigstellung wurde es am 6. Juli 1902 eingeweiht. Es verfügte über einen großen Saal für 400 Personen und das Restaurant Kaiser Franz Joseph I., das nach 1918 in „Gartenrestaurant am Schießplatz“ umbenannt wurde. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Gebäude vom Sportclub Sokol und später von der T.J. Tatran genutzt. Heute befindet es sich in Privatbesitz. Etwa 800 m östlich des Schießplatzes, am Waldrand mit einer alten Sandgrube, wächst die mächtige monumentale Markvartice-Eiche, die 28 Meter hoch ist, einen Umfang von 540 cm hat und auf ein Alter von etwa 200 Jahren geschätzt wird.

Denkwürdige Markvarticer Eiche.
Foto: Jiří Kühn.

J. W. Goethe-Denkmal im Park unterhalb des Bahnhofs.
Foto: Jiří Kühn.
An der Nordseite der Stadt in Richtung Bahnhof befindet sich ein kleiner Park mit einem steinernes Denkmal für Johann Wolfgang Goethe. In der Komenský-Straße steht das zweistöckige Gebäude der ehemaligen Schule der tschechischen Minderheit. Es wurde von dem Turnover (Turnau) Baumeister Karel Salač in einer kurzen Zeitspanne vom 17. März bis zum 14. September 1930 erbaut, als es eingeweiht wurde. Der Unterricht begann am 1. Oktober und im folgenden Jahr wurde eine zweite Klasse eröffnet. Nach der Besetzung des Grenzgebiets im Herbst 1938 wurde die Schule geschlossen und eine Zeit lang von der Hitlerjugend genutzt. Heute beherbergt sie eine Grundschule für behinderte Kinder.

Blick auf das Schloss Nový Falkenburk von der Auffahrt aus. Das Wachterhäuschen auf der linken Seite.
Foto: Jiří Kühn.
Im Park am westlichen Stadtrand steht die Neue Falkenburg, benannt nach der Alten Falkenburg bei Petrovice. Das ursprünglich zweiflügelige Renaissancegebäude mit Schindeldach und Uhrturm wurde von Jindřich Berka von Dubá in den Jahren 1562-1572 an der Stelle des ehemaligen Dorfes und Gerichts Krotenful errichtet. Ab 1599 war das Schloss im Besitz von Margarete Hazlovská von Liběchov, deren Ehemann Vladislav Hazlovský von Hazlov es 1609 wieder an die Berkas von Dubá verkaufte. Im Jahr 1718 erwarben es die Pachtas von Rájov und František Josef Pachta ließ das Schloss in einer spätbarocken Form mit Rokoko-Elementen umbauen, die bis heute erhalten geblieben ist. Der Umbau fand in den Jahren 1756-1758 statt und wurde von dem Prager Baumeister Jan Josef Wirch geleitet, der gegen Ende des Baus wahrscheinlich mit Filip Heger zusammenarbeitete. Im Jahr 1759 wurde das neue Gebäude als Lazarett für verwundete Soldaten aus der blutigen Schlacht von Hochkirch genutzt. Nach 1867 wechselte das Schloss mehrere Besitzer, darunter den Benesov-Fabrikanten František Mattausch. Seine Erben bauten jedoch vor allem den angrenzenden Bauernhof aus, während das Schloss allmählich verfiel und eine Zeit lang als Getreidespeicher diente. Im November 1900 wurde das Schloss von dem Liberecer Industriellen Johann Moritz von Liebieg gekauft, der es renovieren ließ. Die Innenräume wurden mit Stuck und Fresken geschmückt, ein Speisesaal mit reichem Skulpturenschmuck, ein Rittersaal, Jagdsäle, eine Kapelle und ein bemerkenswerter Gedenkraum für Marschall Radetzky wurden eingerichtet. Unter anderem führte Jan Dukát, der zu dieser Zeit in Markvartice lebte, hier Vergoldungs- und Stuckarbeiten aus. Im Jahr 1901 ließ Liebieg den französischen Park in der Nähe des Schlosses anlegen und die Allee nach Česká Ves neu bepflanzen. 1943 wurde das Schloss für die Zwecke des Reichssicherheitshauptamtes beschlagnahmt, nach dem Krieg wurde es konfisziert und 1948 dem Verkehrsministerium als Ausbildungsstätte für die Staatseisenbahnen zugewiesen. Ab 1960 war es eine Berufsschule und später ein Kinderheim, das sich noch heute dort befindet. Nach 2001 wurde das Schloss umfassend rekonstruiert.
Das zweigeschossige Schlossgebäude mit Mansarddach und zentralem Türmchen hat zwei niedrige polygonale Türme mit Glockendächern und kurzen, aneinander grenzenden Erdgeschossflügeln. In der Mitte der Gartenfront befindet sich ein geschwungener Risalit mit abgerundeten Ecken, der mit Stuckmedaillons mit pastoralen Motiven verziert ist. Im Erdgeschoss befinden sich gewölbte Eingangsportale und im ersten Stock ein Balkon, der von einem niedrigen dreieckigen Giebel mit einer Uhr und der Jahreszahl 1570 überragt wird. Die Giebel und alle Ecken sind mit Rokoko-Steinvasen versehen, die auch die Terrassen der unteren Seitenflügel schmücken. Im Speisesaal des Erdgeschosses ist ein Deckengemälde der Göttin Flora erhalten, während sich im ersten Stock der Spiegelsaal mit einem Fresko der Aurora und der vier Jahreszeiten befindet.
Am Zufahrtsweg zum Schloss, der von einer Eichenallee gesäumt ist, steht auf einem hohen Sockel ein einstöckiges Wachterhäuschen. Vor der Schlossfassade befindet sich eine Terrasse mit einer Treppe zum Park, der von einem Holzzaun mit Ziegelpfosten und mehreren Toren umgeben ist. Am nördlichen Ende des Parks befindet sich eine Rokoko-Orangerie aus der Zeit um 1760.

Rokoko-Orangerie am Ende des Schlossparks.
Foto: Jiří Kühn.

Ehemaliger Bauernhof mit barockem Getreidespeicher.
Foto: Jiří Kühn.
An der Nordwestseite des Schlossgeländes befindet sich ein großer Wirtschaftshof mit einem barocken Getreidespeicher, der bereits 1667 erwähnt wird, dessen heutiges Erscheinungsbild aber durch spätbarocke und neobarocke Umbauten bestimmt ist. Das zweigeschossige Backsteingebäude mit Mansarddach ist trotz seines schlechten Zustands ein wertvolles Beispiel für die barocke Schlossarchitektur.
Von der Südseite des Schlosses führen zwei 300 m lange Alleen in Richtung Stadt und Česká Ves. Auf beiden Seiten der Allee nach Česká Ves befinden sich große Feuchtgebiete. Das vernachlässigte Gelände wurde 2005 vom Verein Čmelák erworben, der es nach und nach sanierte und 2013-2014 ein natürliches Erholungsgebiet mit einem System von Tümpeln, Feuchtwiesen und Auenwald entwickelte, das über Holzwege zugänglich und mit Bänken, Tischen, Lehrtafeln und Klettergerüsten für Kinder ausgestattet ist. Zu den Wasserpflanzen, die hier wachsen, gehören zum Beispiel die Sibirische Schwertlilie, die Gelbe Schwertlilie und der Drachenwurz sowie der Kalmus, die Wasserminze, die Gewöhnliche Froschlöffe und der Gewöhnliche Blutweiderich. Zu den interessanten Tieren gehören der Eisvogel, die Ringelnatter, die Teichmolch, die Grasfrosch, der Europäische Laubfrosch und die Bisamratte.

Die Allee, die vom Schloss zur Česká Ves führt.
Foto: Jiří Kühn.

Feuchtgebiet hinter Nový Falkenburk.
Foto: Jiří Kühn.
Bedeutende Landsleute und Persönlichkeiten
Die berühmteste Persönlichkeit von Jablonné ist die heilige Zdislava von Lemberk (um 1220-1252), deren Vater Přibyslav von Křižanov Burgvogt in Brünn und Kastellan auf der Burg Veveří (Burg Eichhorn) war und deren Mutter Sibyla in Begleitung von Kunhuta Štaufská, der Braut von König Wenzel I., nach Böhmen kam. Um 1238 heiratete Zdislava Havel von Lemberk, einen einflussreichen Ritter und Vertrauten des Königs, und gemeinsam gründeten sie in Jablonné ein Dominikanerkloster mit der St.-Lorenz-Kirche, wo sie auch begraben wurde. Zdislava lebte ein frommes Leben und half den Armen und Kranken auf jede erdenkliche Weise. Sie wurde im August 1907 seliggesprochen und am 21. Mai 1995 von Papst Johannes Paul II. für heilig erklärt.
In Jablonné wurden der Schreiber, Dichter und Verfasser historischer Abhandlungen Mathäus Meissner (1543–1600) und der Reisende Georg Tektander (1581–1614) geboren, der als einziger die strapaziöse Reise mit einer Botschaft von Kaiser Rudolf II. am den persischen Schah Abbas dem Großen überlebte. Zur Jahreswende 1604-1605 kehrte er zurück und veröffentlichte 3 Jahre später in Leipzig einen Reisebericht über seine Reise.
Von hier stammen auch der Maler Johann Heinrich Hinkenickel (1720-1796), dessen Gemälde der Vierzehn Nothelfer von 1774 in der Kirche in Kryštofovo Údolí (Christofsgrund) zu sehen ist, der Maler und Designer Otto Maria Porsche (1858-1931), der Professor an der Münchner Kunstakademie war, und der Maler und Dekorateur Wilhelm Reichelt (1861-1934). Auch der Entomologe, Reisende und Illustrator Josef Johann Mann (1804-1889), dessen Schmetterlingssammlungen in mehreren europäischen Museen zu sehen sind, der Musiker und Komponist Josef Knobloch (1831-1908), der später Bürgermeister von Jablonné, Landrat und Landtagsabgeordneter wurde, und der Lehrer, Dichter und Schriftsteller Josef Alfred Taubmann (1859-1938) sind hier geboren. Im benachbarten Markvartice lebte ab 1900 der Künstler und Restaurator Jan Dukát (1849-1926), der sich an der Ausgestaltung von Nový Falkenburg beteiligte und zahlreiche Kapellen, Kirchen und andere Denkmäler in der weiteren Umgebung restaurierte.
Sehenswürdigkeiten in der Umgebung
Jablonné bildet heute eine zusammenhängende Ortschaft mit Česká Ves, Markvartice und der ehemaligen Siedlung Zámecká, wo sich die Burg Nový Falkenburk befindet. Die Hauptstraße von Děčín über Cvikov und Kunratice (Kunnersdorf) nach Rynoltice (Ringelshain) und Liberec verläuft an der Nordseite der Stadt und bildet die südliche Grenze des Landschaftsschutzgebiets Lausitzer Gebirge. Im Nordwesten der Stadt erhebt sich der markante Jezevčí vrch (Limberg). Das breite Tal unter ihm wird von der Straße über Lada (Laaden) nach Heřmanice (Hermsdorf) durchquert, von wo aus sie nach Westen über Paseka (Geräumicht) nach Mařenice (Gross Mergtal) führt, während im Norden eine Bergstraße über Babiččin odpočinek (Großmutters Ruh) nach Krompach (Krombach) abzweigt. Zwischen den beiden Straßen erhebt sich der Zámecký vrch (Schlossberg), an dessen Fuß sich das Naturdenkmal U rozmoklé žáby (Beim nassen Frosch) befindet. Nördlich der Stadt erhebt sich der massive Grenzberg Hvozd (Hochwald) und südöstlich davon der markante Sokol (Falkenberg) mit den Ruinen der Alten Falkenburg. Im Sattel zwischen den beiden Hügeln stand früher das Forsthaus Nr. 6, zwischen dem und Heřmanice die weniger markanten Hügel Kančí (Sauberg) und Kamenný vrch (Steinberg) liegen. In nördlicher Richtung führt eine direkte Straße von Jablonné über Petrovice (Petersdorf) bis zur Staatsgrenze und dann über Lückendorf nach Zittau, zu der vor Petrovice eine lokale Straße aus Lvová (Lämberg) und Kněžice (Groß Herrndorf) führt. Nordöstlich der Stadt liegt ein großes Waldgebiet mit dem markanten Liščí hora (Fuchsberg) und dem Loupežnický vrch (Raubschloss), hinter dem die alte Grenzstraße von Polesí (Finkendorf) an der Tobias-Kiefer vorbei zum Lückendorfer Forsthaus und in das Weißbachtal führt. Darüber erhebt sich der Podkowa-Kamm (Kamm des (Hufeisenbergs) mit dem Aussichtspunkt Popova skála (Pfaffenstein) und Sedlecký Špičák (Görsdorfer Spitzberg), an dessen Südostseite sich das tiefe Císařské údolí (Kaisergrund) befindet. Die Straße, die ihn durchquert, führt über Dolní Sedlo (Spittelgrund) hinunter nach Hrádek nad Nisou (Grottau) im Tal der Lužické Nisa (Lausitzer Neiße). Am Osthang oberhalb des Císařské údolí befinden sich die zerklüfteten Vraní skály (Rabensteine) und die langgestreckten Kämme mit den bei Kletterern beliebten Horní skály (Oberwegsteine). Die Straße von Hrádek nad Nisou über Černá Louže (Schwarzpfütz) nach Rynoltice führt durch das nahe Horní Sedlo (Pass) und weiter südlich liegt Janovice v Podještědí (Johnsdorf) mit mehreren Teichen, Svatá skála (Heiliger Stein) und Janovické Poustevny (Johnsdorfer Einsiedelei). Die malerische Landschaft in der Umgebung von Lvová wird durch das Schloss Lemberk gekrönt, unterhalb dessen sich im Tal der vielbesuchte Zdislava-Brunnen befindet. Im Südosten führt eine Nebenstraße von Jablonné und Česká Ves über Valdov (Waldau) und Dubnice (Hennersdorf) nach Stráž pod Ralskem (Wartenbrg am Roll), und im Süden führt die Hauptstraße an Postřelná (Postrum) vorbei nach Mimon (Niemes), über dem sich der mächtige Berg Tlustec (Tolzberg) erhebt. Fast parallel zum Tal des Panenský potok (Jungfernbach) führt eine Straße durch Velký Valtinov (Groß Walten) nach Brniště (Brims), vorbei an den kleineren Siedlungen Tlustce (Tölzeldorf), Tlustecká (Tolzbach) und Růžové (Rosenthal) mit dem kleinen Hügel Kaple (Schröters Kapelle). Südwestlich von Jablonné liegen Wälder mit einem unscheinbaren Selský vrch (Bauerberg) und mehreren kleinen Teichen in der Umgebung.
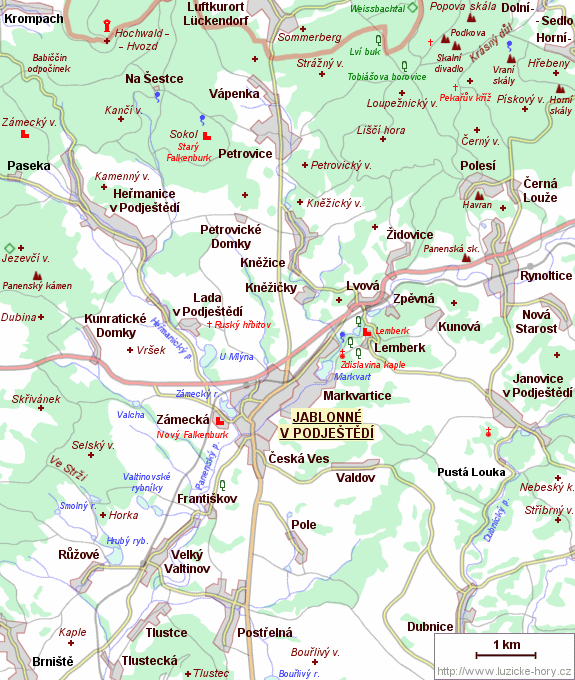
Weitere Informationen
- Historische Bilder von Jablonné v Podještědí
- Historische Bilder des Schlosses Nový Falkenburk
- Aussicht vom Turm der ehemaligen Kirche Mariä Geburt in Jablonné v Podještědí
- Unterkunft - Jablonné v Podještědí