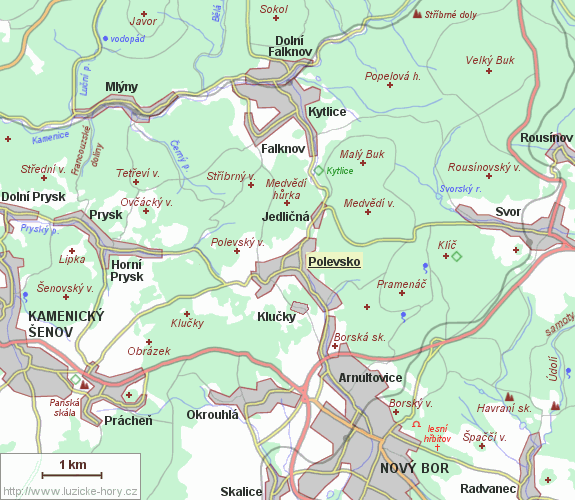Polevsko
(Blottendorf)
Polevsko (Blottendorf) liegt im oberen Teil des Sporka-Tals (Rohnbach-) oberhalb von Arnultovice (Arnsdorf), etwa 3,5 km nordwestlich von Nový Bor (Haida). Zu Polevsko gehören auch die Siedlungen Klučky (Klutschken) und Jedličná (Tanneberg), mit denen Polevsko am 1. Januar 2011 insgesamt 370 Einwohner hatte.
Geschichte

Der obere Teil des Dorfes mit der Kirche der Heiligen Dreifaltigkeit. Im Hintergrund ist der Polevský vrch zu sehen.
Foto: Jiří Kühn.
Das Dorf entstand auf dem Gebiet des ehemaligen Grenzwaldes, in den bereits im 13. oder 14. Jahrhundert Glasmacher kamen, deren Hütten große Mengen an Holz verbrauchten. Die älteste Glashütte stand laut lokaler Überlieferung im Wald Gross Seifert am südlichen Fuß des Medvědí vrch (Bärenberg) an der heutigen Straße nach Svor (Röhrsdorf). Ihr genauer Standort ist jedoch bisher nicht bekannt. Die ersten Siedler hier sollen die Glasmacher Oppitz aus Bayern und Preyssler aus Schlesien gewesen sein. Einige von ihnen hatten sich möglicherweise bereits zuvor in der Gegend von Horní Blatná (Bergstadt Platten) im Erzgebirge niedergelassen, von wo aus sie in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts in das Lausitzer Gebirge zogen und dort ein neues Dorf gründeten, das sie nach Blatná (deutsch Platten, Blatten) Blattendorf nannten. Die älteste schriftliche Erwähnung des Dorfes stammt aus den Jahren 1471–1481.
Im Laufe des 17. Jahrhunderts entwickelten sich hier neben der Glasherstellung auch Heimwerkbetriebe, die sich auf die Veredelung von Glas durch Schneiden, Schleifen, Bemalen und später auch Ätzen konzentrierten. Die wachsende Zahl der Glasmacher führte zur Gründung eigener Zünfte, von denen die erste 1661 auf der Herrschaft Kamnitz in Chřibská (Kreibitz) entstand. Am 15. März 1683 verlieh Ferdinand Hroznata von Kokořov, Besitzer des Guts Sloup (Bürgstein), den Glasveredlern aus Polevsko und Falknov (Falkenau) Zunftprivilegien. Die Entwicklung des Glaserhandwerks hing vom Absatz ab. Da der heimische Markt schnell gesättigt war, musste man Absatzmöglichkeiten im Ausland suchen. Als Hauptpionier des Glashandels gilt meist Johann Caspar Kittel, der 1680 die Rollhütte am Hutní rybník (Hüttenteich) unterhalb von Jedlová (Tannenberg) gründete. Die Zolltarife von Zákupy (Reichstadt) aus dem Jahr 1613 belegen, dass Glas schon lange zuvor ins Ausland transportiert wurde. Kittel soll die Auslandserfahrungen von Scherenschleifern genutzt und ihnen angeboten haben, auch Glas zu verkaufen. Sein Versuch inspirierte dann weitere Exporteure, die das Glas in Körben, auf Karren und die reicheren sogar auf Wagen transportierten. Nach und nach drangen sie in immer weiter entfernte Gebiete vor, bis sie die norddeutschen Städte, Hamburg und um 1700 sogar Portugal erreichten. Christian Franz Rautenstrauch begab sich 1710 auf Anregung von Kittel nach St. Petersburg. Seine erfolgreiche Reise öffnete dem dortigen Glas nicht nur die Türen nach Russland, sondern auch in die Türkei und weiter in den Osten. Rautenstrauch wandte sich dann dem portugiesischen Markt zu und ging später nach Spanien, wo er mehrere Niederlassungen gründete. Um 1740 gründete er zusammen mit anderen Partnern in Polevsko eine der ersten Handelsgesellschaften – Kompanien –, die dank Handelsvertretungen und Niederlassungen im Ausland die Herstellung von Glaswaren nach den Wünschen und Anforderungen der Kunden sicherstellten. Später dehnte sich das Handelsgeschäft von Polevsko auch auf die umliegenden Gemeinden aus.
Der Handel mit Glas war sehr lukrativ, sodass Johann Caspar Kittel zwischen 1716 und 1718 einen Großteil der Kosten für den Bau der Kirche in Polevsko übernehmen konnte. 1735 trug er auch zur Gründung der örtlichen Pfarrei bei, damit die Einwohner nicht mehr zur Kirche in Skalice (Langenau) gehen mussten. Im Jahr 1716 wurde im Dorf auch eine Schule gegründet, an der ab Oktober 1795 der aus Žandov (Sandau) stammende Christoph Mösner tätig war.

Blick vom Friedhof auf die Häuser im oberen Teil des Dorfes.
Foto: Jiří Kühn.
Im Jahr 1720 entstand südlich von Polevsko die Siedlung Klučky und 30 Jahre später wurde im Tal in Richtung Kytlice (Kittlitz) Jedličná gegründet. In den Jahren 1739–1789 ließ sich der Einsiedler Eleazar Oppitz in den Wäldern nördlich des Dorfes nieder, dessen Einsiedelei, genannt „Tillhäusel” (= Tills Häuschen), 1875 abgerissen wurde.
Im 18. Jahrhundert war die Gemeinde von den Kriegen mit Preußen betroffen, insbesondere von den langwierigen Aufenthalten der Truppen, die von den Einwohnern versorgt werden mussten. Im Frühjahr 1743 wurde auch der Kaufmann Christian Rautenstrauch Opfer der Preußen, der in der Nähe seines Hauses überfallen und als Spion auf einem Pferd zum preußischen Lager verschleppt wurde. Nach einigen Tagen wurde er zwar freigelassen, starb aber bald darauf an den Folgen seiner Leiden. Beim Rückzug der Preußen nach der Niederlage bei Kolín starb im Juli 1757 in Polevsko der preußische Husar Gottfried Seydelmann, der hier begraben wurde und dem 1902 an der Kirche eine Gedenktafel gewidmet wurde. Während der Napoleonischen Kriege im Jahr 1813 mussten die Einwohner von Polevsko wiederum das französische Militärlager auf dem Široké pole (Breitfeld) nördlich des Dorfes versorgen. Die Glasherstellung wurde damals durch die Blockade des Außenhandels stark beeinträchtigt. Ihre Wiederbelebung ist vor allem Friedrich Egermann zu verdanken, der einige Zeit in Polevsko in den Häusern Nr. 58 und 70 lebte. Zu dieser Zeit war jedoch bereits das günstiger gelegene Bor zum Zentrum der Glasherstellung und des Handels geworden, wohin Egermann um 1820 auch umzog. Das Glaserhandwerk blieb jedoch in Polevsko erhalten. Im Jahr 1820 gab es hier zwei Maler, zwölf Kugler, zwei Vergolder und fünf Glasschleifer, einen Bohrer und zwei Hersteller von Glasformen. Die Landwirtschaft spielte aufgrund der ungünstigen natürlichen Bedingungen keine große Rolle. Laut erhaltenen Aufzeichnungen gab es in der Gemeinde nur vier Bauern und elf Kleinbauern.

Zweistöckiges Fachwerkhaus mit Mansarddach.
Foto: Jiří Kühn.
Im Revolutionsjahr 1848 wurde in Polevsko eine Bürgerwehr gegründet, die hinsichtlich ihrer Organisation, Ausrüstung und mit 144 Mann zu den besten im Herrschaftsgebiet von Sloup gehörte. Die Reform der Staatsverwaltung im Jahr 1850 brachte dem Dorf eine eigene Selbstverwaltung mit einem gewählten Bürgermeister.
Ein Brand in der Nacht vom 30. auf den 31. Mai 1856 zerstörte eine große Anzahl von Häusern im Dorf. Die meisten davon wurden bald wieder aufgebaut. Im Jahr 1869 erreichte Polevsko mit 1422 Einwohnern seinen höchsten Stand. Die örtliche Schule wurde bereits 1820 auf zwei Klassen erweitert und 1873 auf drei Klassen. Doch auch das reichte nicht lange aus, sodass in den Jahren 1878–1879 ein neues Schulgebäude errichtet wurde, das nach verschiedenen Umbauten bis heute für den Unterricht genutzt wird. Es wurde am 14. Juli 1879 mit vier Klassen feierlich eröffnet und 1894 um eine fünfte Klasse erweitert. Im Jahr 1880 wurde in der Gemeinde auch ein Postamt eingerichtet. Als im November 1887 in Arnultovice eine altkatholische Gemeinde gegründet wurde, schloss sich ihr bald auch die Filialgemeinde in Polevsko an.
Seit den 1870er Jahren machte sich in der Glasherstellung ein Mangel an Rohstoffen bemerkbar, die aus immer weiter entfernten Orten importiert werden mussten. Erst nach der Einführung einer neuen Technologie zum Beheizen der Öfen mit Kohle und dem Bau einer Eisenbahn, die einen kostengünstigen Transport ermöglichte, konnten neue Glashütten in Bor, Kamenický Šenov (Steinschönau), Kytlice, Skalice, Svor und auch in Polevsko gebaut werden.

Blick über den mittleren Teil des Dorfes mit der Schule nach Jedličná.
Foto: Jiří Kühn.
Im Jahr 1897 wurde hier das Glasgeschäft der Brüder Handschke gegründet, das zusammen mit der Raffinerie von Raimund Knöspel einen Großteil der Bevölkerung ernährte, die Glas zu Hause als Schleifer, Kugelschleifer, Mattierer, Bohrer, Versilberer, Vergolder, Graveure und Maler veredelten. Im Jahr 1907 gründete Karl Mühlbauer im unteren Teil des Dorfes die Glashütte Klára, und drei Jahre später wurde in ihrer Nähe die Glashütte Anna von Rudolf Handschke errichtet. Im Dorf gab es noch einige kleinere Exportfirmen und die Samtschneiderei von Ignaz Richter.
Die vielversprechende Entwicklung wurde jedoch durch den Ersten Weltkrieg unterbrochen, der Armut, Nahrungsmittelknappheit und einen Mangel an anderen lebensnotwendigen Gütern mit sich brachte. Vor Kriegsende, am 21. Mai 1918, marschierten Rebellen der Militärgarnison Rumburk durch Polevsko nach Arnultovice, wo sie eine Patrouille der Grenzjäger aus Nový Bor gefangen nahmen. Nach Kriegsende kam es zu einer erneuten Belebung der Produktion, doch Ende 1929 setzte die Wirtschaftskrise ein und die Produktion in beiden Glashütten in Polevsko kam zum Erliegen. 1932 pachteten die Glasarbeiter die Glashütte Klára, die sie Rudihuť nannten, und versuchten, ihre Produkte zu niedrigen Preisen auf dem Markt zu verkaufen. Unter der Leitung von Emanuel Beránek wurde der Betrieb der Hütte bis zur Besetzung des Grenzgebiets durch Deutschland im Oktober 1938 aufrechterhalten.
Noch im Jahr 1930 hatte Polevsko 1316 Einwohner, aber nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Mehrheit von ihnen nach Deutschland umgesiedelt. Da deutlich weniger neue Einwanderer aus dem tschechischen Landesinneren kamen, lebten hier 1950 nur noch 403 Einwohner. Viele Häuser blieben verlassen und viele wurden abgerissen. Diejenigen, die stehen blieben, wurden später von Ferienhausbesitzern vor dem Verfall bewahrt. Der Betrieb in der Glashütte Anna wurde nach dem Krieg nicht wieder aufgenommen und um 1950 abgerissen. Die Glashütte Klára war seit 1956 im Besitz des Unternehmens Borské sklo und später des Staatlichen Forschungsinstituts für Glas in Hradec Králové (Königgrätz). In den 1990er Jahren wechselte die Hütte den Besitzer und war unter dem ursprünglichen Namen Klára bis Dezember 2024 in Betrieb, als sie ihren Betrieb einstellte.
Im Jahr 1980 wurde Polevsko zwangsweise an Nový Bor angegliedert, aber nach dem politischen Wandel im Sommer 1990 wieder unabhängig. Seitdem verändert sich die Gemeinde allmählich zum Besseren, eine Reihe von Häusern und kleineren Kapellen oder Kreuzen wurden renoviert. Nach 2011 wurde auch die Kirche mit dem angrenzenden Friedhof rekonstruiert.
Denkmäler und Merkwürdigkeiten

Kirche der Heiligen Dreifaltigkeit.
Foto: Jiří Kühn.
Auf einer Anhöhe im oberen Teil des Dorfes steht die Kirche der Heiligen Dreifaltigkeit, die von Peter Paul Columbani in den Jahren 1716–1718 erbaut und am 10. Juli 1718 geweiht wurde. In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts wurde sie erneut umgebaut. Am 19. Juli 1939 brannte sie nach einem Blitzschlag nieder, wurde jedoch im Laufe des Jahres wieder instand gesetzt. Nach dem Zweiten Weltkrieg verfiel die Kirche langsam, bis im April 2011 mit ihrer Rekonstruktion begonnen wurde. Das barocke einschiffige Bauwerk hat auf der Nordostseite einen prismatischen Turm mit einer Zwiebelkuppel, im Giebel der Südwestfassade befindet sich eine Nische mit einer Skulptur der Heiligen Dreifaltigkeit und die Südostwand ziert eine Sonnenuhr. Die Innenausstattung besteht aus einem Hauptaltar und zwei Seitenaltären aus dem 19. Jahrhundert, einer Kanzel aus der Zeit um 1800, die im 19. Jahrhundert umgebaut wurde, einem spätbarocken Taufbecken und einer Orgel aus dem Jahr 1941.
Die Kirche ist von einem Friedhof umgeben, der teilweise auf einer Terrasse angelegt und von einer Mauer umgeben ist. Am Rand der Terrasse steht eine Gruft, die 1898 vom Glasunternehmer Rudolf Handschke erbaut wurde. Die achteckige neugotische Kapelle mit Buntglasfenstern hat an ihrer Spitze einen Turm mit einem pyramidenförmigen Dach. Unter dem Boden befindet sich eine gewölbte Grabkammer, die über eine Innentreppe zugänglich ist. In den Jahren 2007 bis 2010 wurde die baufällige Grabstätte renoviert. Auf dem Friedhof befinden sich auch mehrere interessante Grabsteine aus dem 18. und 19. Jahrhundert.

Grabstätte der Glasmacherfamilie Handschke.
Foto: Jiří Kühn.

Friedhof mit alten Grabsteinen und der Grabstätte der Familie Handschke im Hintergrund.
Foto: Jiří Kühn.

Kapelle der Schmerzensreichen Mutter Gottes im oberen Teil des Dorfes.
Foto: Jiří Kühn.
An der Kreuzung etwa 100 m südöstlich der Kirche steht die Kapelle der Schmerzensreichen Mutter Gottes, die 1900 für die Gläubigen der altkatholischen Kirche erbaut wurde. Früher stand neben ihr ein kleiner Glockenturm. 1927 wurden hier zwei Linden gepflanzt. Im Jahr 2001 wurde die baufällige Kapelle renoviert und am 29. Juli desselben Jahres feierlich geweiht.

Ehemaliges Pfarrhaus unterhalb der Kirche.
Foto: Jiří Kühn.
In der Gemeinde sind zahlreiche mehrstöckige Fachwerkhäuser erhalten geblieben, darunter das denkmalgeschützte ehemalige Pfarrhaus Nr. 1 mit Mansarddach unterhalb der Kirche und das etwas höher gelegene Fachwerkhaus Nr. 14. An der Abzweigung der Straße nach Klučky steht das Haus Nr. 110 mit gemauertem Erdgeschoss und Fachwerkgeschoss. Etwas oberhalb der Kreuzung in der Mitte des Dorfes befindet sich ein weiteres Fachwerkhaus Nr. 53 mit Mansarddach. Ein weiteres Kulturdenkmal ist das Gelände der Glashütte Klára am unteren Rand des Dorfes.
Im Dorf gibt es auch mehrere Kreuze. An einem schönen Ort etwa 150 m hinter dem Dorf an der Straße nach Klučky steht das Janke-Kreuz aus dem Jahr 1834, das 2007 restauriert wurde. An der Kreuzung im Zentrum des Dorfes steht ein kürzlich renoviertes Kreuz mit einer Darstellung der Kalvarienbergszene, gemalt auf Blech, das am 27. Oktober 1822 vom Kaufmann Anton Lorenz errichtet wurde. Im Garten des Hauses Nr. 134 am nördlichen Ende des Dorfes steht eine Statue des Heiligen Johannes Nepomuk, die seit 1820 einen der Pfeiler des Friedhofstors schmückte. Im Jahr 1837 wurde sie jedoch vom Tor entfernt. Da ihr ein Arm fehlte, ließ Vinzenz Knöspel sie reparieren und stellte sie 1838 an ihrem heutigen Standort auf. 200 m weiter oben, in einer Kurve der Straße bei Jedličná, befindet sich ein Denkmal für den bekannten Kinderdarsteller Tomáš Holý, der hier am 8. März 1990 einen Unfall hatte, an dessen Folgen er nach der Überführung ins Krankenhaus von Nový Bor starb.
Am oberen Ende des Dorfes befindet sich ein kleiner Park mit einem Denkmal für die Gefallenen des Ersten Weltkriegs, das vom Děčíner (Tetschen) Architekten Rudolf Görtler entworfen und am 23. September 1923 enthüllt wurde. Etwa 350 m westlich davon stand an der Straße nach Prácheň (Parchen) die Knäspel-Kapelle aus dem Jahr 1820, die von der Familie der Glashändler Knäspel erbaut wurde. In den 1950er Jahren wurde die Kapelle jedoch zerstört und 2008 an ihrer Stelle eine neue Nischenkapelle mit einem gemalten Bild von Jesus auf dem Ölberg errichtet, die am 31. August 2008 vom Generalvikar der Diözese Litoměřice (Leitmeritz), Karel Havelka, feierlich geweiht wurde.

Statue des Heiligen Johannes Nepomuk.
Foto: Jiří Kühn.

Park mit Denkmal für die Gefallenen des Ersten Weltkriegs.
Foto: Jiří Kühn.

Knäspel-Kapelle an der Straße nach Prácheň.
Foto: Jiří Kühn.
Bedeutende Landsleute und Persönlichkeiten
In Polevsko wurde der Glasmeister und Pionier des Glashandwerks Johann Caspar Kittel geboren, der hier unter anderem die Herstellung von klarem, farblosem Glas nach dem Vorbild der venezianischen Glasmacher einführte. Ebenfalls aus Polevsko stammte der römisch-katholische Priester und Professor für kanonisches Recht, Philosophie und Theologie Stephan Rautenstrauch (1734–1785), der ab 1773 als Abt des Klosters Břevnov-Broumov (Breunau-Braunau) tätig war und ein Jahr später zum Direktor der theologischen Fakultät in Prag und später in Wien ernannt wurde. Aus der Familie Preissler stammte der Priester, Lehrer und Dekan von Česká Lípa Johann Christoph Preisler (+1796), der auch Autor einer Reihe von Sonaten und Konzerten war. Das Mitglied des Augustinerordens und Lehrer Alexandr Gürtler (+1775) war am Gymnasium in Česká Lípa tätig und leitete später die Hofkapelle des ungarischen Magnaten Batthyanyi. Jakub Helzel (*1809) war als Organist in Riga tätig, und Franz Johann Stabler (1829–1868) nahm nach einer kurzen Tätigkeit im Orchester von Johann Strauss eine Stelle an der Oper in St. Petersburg an.
Sehenswürdigkeiten in der Umgebung
Polevsko mit den Weilern Klučky (Klutschken) und Jedličná (Tannenberg) liegt am Ende des Sporka- (Rohnbach-) Tals oberhalb von Arnultovice (Arnsdorf) und Nový Bor (Haida). Westlich des Dorfes erstreckt sich der bewaldete Bergrücken Klučky mit einem interessanten Basaltsteinbruch und schönen Ausblicken auf die umliegende Landschaft. Auf der Nordseite des Bergrückens führt eine kleine Straße nach Prácheň (Parchen), wo sich der bekannte Felsen Panská skála (Herrenhausfelsen) und der unscheinbare Aussichtspunkt Vyhlídka (Kühlberg) mit einer kleinen Skipiste befinden. Hinter Prácheň liegt die Glasstadt Kamenický Šenov (Steinschönau) und im benachbarten Tal unterhalb des Šenovský vrch befindet sich die Gemeinde Prysk (Preschkau), über der sich der bewaldete Ovčácký vrch (Schäferberg) und der felsige Střední vrch (Mittenberg) mit schöner Aussicht erheben. Direkt über Polevsko liegt der langgestreckte Kamm des Polevský vrch (Blottendorfer Berg) mit einem Skigebiet und schönen Ausblicken auf die Umgebung, an den im Nordosten der Medvědí hůrka (Bärenfang) mit dem Stříbrný vrch (Silberhübel) anschließt. Hinter dem Sattel bei Jedličná setzt sich der Bergrücken nach Osten über den Medvědí vrch (Barhübel) bis zum Malý Buk (Kleiner Buchberg) und zum markanten Berg Klíč (Kleis) fort, von dessen Gipfel aus sich ein wunderschöner Rundblick in die ferne Umgebung bietet. Aus den Wäldern unterhalb des Klíč ragt der niedrigere Pramenný vrch (Bornberg) mit dem Břidlicný vrch (Schieferberg) hervor, und im Tal nordöstlich unterhalb des Klíč und des benachbarten Rousínovský vrch (Hamrich) liegt Svor (Röhrsdorf). Hinter dem Bergrücken nördlich von Polevsko liegt das malerische, bewaldete Tal Kamenice (Kamnitz) mit den Erholungsorten Kytlice (Kittlitz) und Mlýny (Hillemühl).