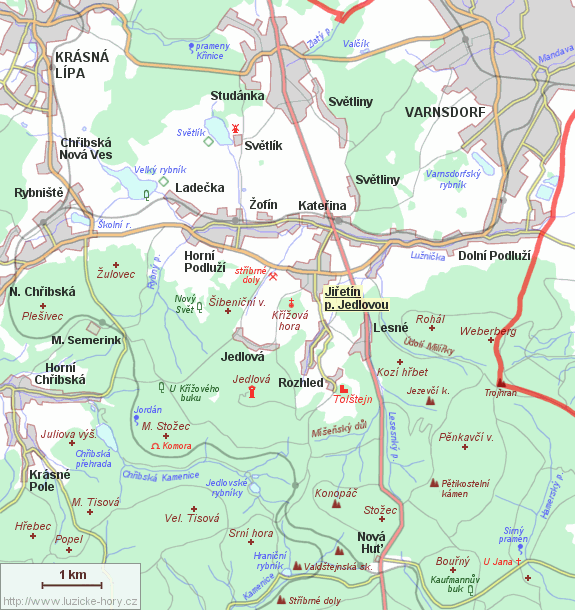Jiřetín pod Jedlovou
(St. Georgental)

Gesamtansicht vom Norden. Im Hintergrunde Jedlová (Tannenberg) und Křížová hora (Kreuzberg).
Foto: Jiří Kühn.
Jiřetín (St. Georgental) ist ein kleines, aber schmuckes Städtchen am Nordfusse des Lausitzer Gebirges und liegt etwa 5 km südwestlich von Varnsdorf links von der Hauptstrasse Česká Lípa - Rumburk. Dank der malerischen Umgebung, den interessanten Denkmälern und den reichen Möglichkeiten, die es zur Freizeitgestaltung bietet, ist Jiřetín ein das ganze Jahr über besuchter Erholungsort. Zur Erholung dienen auch die zum Städtchen gehörenden abgelegenen Ortsteile Jedlová (Tannendorf), Lesné (Innozenzendorf) und Rozhled (Tollenstein).
Geschichte

Blick von Tolštejn auf Jiřetín pod Jedlovou (St. Georgenthal, links im Vordergrund) mit einem Teil von Dolní-Podluží (Niedergrund).
Foto: Jiří Kühn.
Die Geschichte von Jiřetín ist vom Anfange an mit den Schicksalen
der Herrschaft Tolštejn-Rumburk (Tollenstein - Rumburg) und insbesondere mit
den hiesigen Erzbergwerken verbunden. Die ältesten Nachrichten über den Bergbau
auf der Herrschaft Tollenstein stammen aus den Jahren 1474 und 1484. Da damals
zur Herrschaft Tollenstein auch das ganze Schluckenauer Land gehörte, ist nicht
nachgewiesen, ob sich diese Anmerkungen auf die unmittelbare Umgebung von Jiřetín
oder auf einen anderen Teil der Herrschaft beziehen (es soll sich dabei aber
eher um Georgental in Thüringen handeln). Trotzdem der Bergbau nicht allzu erträglich
war, erteilte im Jahre 1509 König Vladislaus II. der Jagielonner dem Herren
Heinrich von Schleinitz das Recht, zwanzig Jahre auf der Herrschaft Tolštejn
auf Gold, Silber, Kupfer, Blei, Zinn, Eisen und andere Metalle zu bauen. Diese
Versuchsarbeiten fanden zuerst wahrscheinlich im Míšeňská dolina
(Meisengrund) unterhalb des Tolštejn
(Tollenstein), im gegenüberliegenden Tale unter dem Kozí
hřbet (Ziegenrücken) und im Tale Milířka
(Kohlhau) südlich von Dolní Podluží (Niedergrund)
statt.
Der neue Besitzer der Herrschaft, Georg von Schleinitz, erweiterte den hiesigen
Bergbau auf Kupfer, Blei und Silber und liess auf neue Vorkommen schürfen. Als
hoffnungsvoll erschien damals das Gebiet des Berges Křížová
hora (Kreuzberg), in dem er einen Stollen zum St. Christoph vortreiben liess.
Zugleich entschied er sich, die Entwicklung des Bergbaus durch die Gründung
eines Städtches zu unterstützen, dem er in der Urkunde vom 21. Juli 1539 eine
Fläche an der Pražská cesta (Prager Strasse)
zwischen dem Křížová hora (Kreuzberg) und dem
Tolštejn (Tollenstein) anwies. Das neue Städtchen
wurde nach dem Namenspatron des Gründers Sanct Georgenthal genannt. Der Bau
des Städtches begann im Jahre 1548 und wurde in fünf Jahren, 1553 abgeschlossen.

Ehemalige Pfarrei mit Heilige Dreifaltigkeits-Kirche auf dem Marktplatz.
Foto: Jiří Kühn.
Anfangs entwickelte sich das Städtchen schnell, da die Aussicht auf einen schnellen
Gewinn und die in der Gründungsurkunde Georgs von Schleinitz vom 12. November
1554 verankerten reichen Privilegien neue Einwohner anzogen. Sie sicherten den
Hauseigentümern das Recht, Bier zu brauen und verkaufen, Brot backen, schlachten
zu und sie bekamen die volle Freiheit, andere Geschäfte und Handwerke auszuüben.
Dabei waren sie von allen Abgaben und Zöllen befreit. Die Einwohner hatten auch
das Recht frei mit ihrem Eigentum zu schalten, frei sich anzusiedeln und auszusiedeln
und es wurden ihnen gleichfalls alle Schulden, die sie ausserhalb der Länder
der Böhmischen Krone zurückliessen, erlassen.
Der Bergbau unterlag dem Joachimstaler Recht und wurde von einer Gesellschaft
von Gewerken ausgeführt, die eine privilegierte Bevölkerungsschicht darstellte.
Der hiesigen Überlieferung nach arbeiteten im Jahre 1539 hier etwa 30 Bergleute
und in den folgenden Jahren kamen noch etwa 150 Bergmannsfamilien aus dem Harz
hierher.

Häuser auf der Nordseite des Marktplatzes.
Foto: Jiří Kühn.
Die Ergebnisse des Bergbaues waren anfangs augenscheinlich
gut, denn 1569 verlängerte Georg Schleinitz die Gültigkeit der Georgentaler
Privilegien auf weitere 15 Jahre. Die nicht allzu reichen Vorräte waren aber
schnell erschöpft, sodass im Jahre 1584 die Gültigkeit der Privilegien nur noch
um drei Jahre verlängert wurde und danach den Bürgern von Jiřetín die gewohnten
Untertanenabgaben und -dienste vorgeschrieben wurden, wodurch sie zu den gleichen
hörigen Bürgern wie den der anderen Städte wurden.
Der Bergbau wurde aber nicht ganz eingestellt. Noch im Jahre 1612 war im Städtchen
das Amt des Berg- und Hüttenmeisters geblieben und um das Jahr 1620 waren die
Gruben wieder im Betrieb. Diese kurze Zeit des Aufschwungs wurde durch den 30jährigen
Krieg unterbrochen, aber es heisst, dass noch in den Jahren 1639 und 1640 die
Bürger von Jiřetín die Bestätigung ihrer Bergbauprivilegien angestrebt haben.
Versuche, den Bergbau wieder zu beleben, wurden auch in späteren Zeiten wiederholt,
meistens aber ohne greifbare Erfolge. Den bedeutendsten davon unternahm Alois
von Liechtenstein am Ende des 18. Jahrhunderts. Dabei wurde im Křížová
hora (Kreuzberg) ein neuer Stollen, der St. Johann Evangelisten-Stollen
aufgefahren. Vereinzelte Versuche zur Erneuerung des Bergbaues folgten bis in
die ersten Jahre des 20. Jahrhunderts.

Gemeindeamtgebäude auf dem Marktplatz.
Foto: Jiří Kühn.
Nach dem Tode Georgs 1565 verschuldeten sich die Herren von Schleinitz und mussten
im Jahre 1586 die Herrschaft Rumburg an Georg Mehl v. Strehlitz verkaufen. Unter
seiner Herrschaft erhob Kaiser Rudolf II. am 18. Dezember 1587 Jiřetín zur Bergstadt
und erteilte ihm eine eigene Petschaft und Wappen. Zu den bisherigen Privilegien
kamen noch zwei Jahrmärkte.
Nach dem Ableben Georg Mehls im Jahre 1589 wechselte die Herrschaft Rumburg
mehrmals ihre Besitzer, unter denen der Bekannteste Vilém Vchynský von Vchynic
war, der mit Albrecht von Waldstein im Jahre 1634 in Cheb (Eger) ermordet wurde.
Im Bauernaufstand des Jahres 1680 zerstörten die Aufständischen die Ausstattung
des Rathauses von Jiřetín, weil sich die Bürger weigerten, am Aufstand teilzunehmen.
Dem Stadtrat wurde darum für ihre Stellungnahme vom Befehlshaber des Hilfseinheiten,
dem General Christoph Wilhelm Harrant und dem damaligen Herrschaftsbesitzer
Johann Sebastian v Pötting ein Lob ausgesprochen. Im Januar 1681 kaufte die
Rumburger Herrschaft Anton Florian v. Lichtenstein, mit dessen Familie dann
die Geschichte der Stadt und der ganzen Herrschaft bis 1919 verknüpft blieb.
Wegen seiner Lage an einem wichtigen, in das Innenland führendem
Verkehrswege litt Jiřetín in Kriegszeiten viel durch die häufigen Durchzüge
fremder und eigener Armeen. Im Jahre 1643 verbrannten in einem der Scharmützel
des Dreissigjährigen Krieges die Schweden die Burg Tolštejn
(Tollenstein), die seitdem wüst liegt.
Bis zum Jahre 1765 besass die Stadt auch seine peinliche Gerichtbarkeit, zu
deren Vollstreckung die Richtstätte auf dem Šibeniční
vrch (Galgenberg) diente. Nach einem der drei erhalten gebliebenen Todesurteile
wurde am 12. Oktober 1747 ein gewisser Friedrich Rauch, dessen Namen in der
Volkssage mit der Höhle am Malý Stožec (Kleiner
Schöber) in Verbindung gebracht wird, wegen Kirchenfrevel zum Galgen verurteilt.

Ein zweigeschossiges Fachwerkhaus an der Westseite des Platzes.
Foto: Jiří Kühn.
Da die Landwirtschaft in dieser Gegend keine grössere Bedeutung
hatte, wurde nach dem Niedergang des Bergbaues das Handwerk, ven dened die Leinenindustrie
und Weberei die wichtigsten waren, zur wichtigste Quelle des Lebensunterhaltes
der Einwohner. An der Wende des 18. und 19. Jahrhunderts begann sich auch die
Herstellung von Manchester und anderen Leinen- und Baumwollstoffen durchzusetzen.
Diese Entwicklung der Leinenweberei führte in der Umgebung zur Entstehung von
Bleichereien, die bis zum Anfange des 20. Jahrhunderts arbeiteten, dann aber
infolge der Entwicklung der Chemie und der Mechanisierung der Fabriken eingingen.
Jiřetín wuchs bis zum Jahre 1890, in dem er 2530 Einwohner erreichte; später
vergrösserte sich seine Einwohnerzahl nicht mehr, hauptsächlich wegen der stürmischen
Entwicklung der Industrie im nahen Varnsdorf (Warnsdorf). In der Wirtschaftskrise
der 30. Jahre wurde die industrielle Produktion in Jiřetín allmählich ganz eingestellt
und diese drückende Lage dauerte dann bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges.
Durch die Aussiedlung der Sudetendeutschen sank die Einwohnerzahl auf etwa ein
Drittel, und da es auch später nicht gelang, die industrielle Produktion in
einem ausreichenden Ausmasse zu erneuern, sank die Einwohnerzahl weiter bis
auf die heutigen etwa 560. Die Zahl der Landhausbesitzer erreicht ungefähr die
gleiche Höhe.
Nach dem Kriege benutzte das Städtchen eine Zeit lang den aus dem Deutschen
übernommenen Namen Sv. Jiřetín ("Skt. Georgental") und erst im Jahre nach dem
Zusammenschluss mit dem benachbarten Rozhled (Tollendorf),
zu dem auch die Ortschaften Lesné (Innozenzidorf) und Jedlová
(Tannendorf) gehörten, wurde es auf Jiřetín pod Jedlovou ("Georgental unter
dem Tannenberg") umbenannt.
Denkmäler und Merkwürdigkeiten
Jiřetín ist ein typisches Bergstädtchen der Renaissancezeit
mit eim schachbrettartigen Grundriss. Den Grundstein bildet der quadratische
Marktplatz, um den ein sich regelmässiges Netz von untereinander senkrechten
Strassen in den vier Weltrichtungen entwickelte. Zwischen des Gassen wurden
quadratische Häuserblocks, an deren Seiten je drei Häuser standen, ausgemessen.
Dadurch erreichte man, dass die Stadt niemals ganz ausbrannte. Im Jahre 1584
wurden 14 Häuser Raub der Flammen, im Jahre 1619 nur drei.
Da sich Jiřetín schon seit der Hälfte des 19. Jahrhunderts nicht mehr weiter
entwickelte, hat es sich bis heute als ein aussergewöhnlich wertvolles Ganzes
erhalten; sein Zentrum wurde deshalb im Jahre 1992 zu einer städtischen Denkmalszone
erklärt.

Die Heilige Dreifaltigkeits-Kirche zu auf dem Marktplatz.
Foto: Jiří Kühn.
In der Mitte des Marktplatzes steht die urprünglich im Renaissancestil gebaute
Heilige Dreifaltigkeits-Kirche, deren Bau im Jahre 1587 oder 1590 begonnen
wurde, aber wegen der Verschuldung des Besitzers der Herrschaft, Balthasar Mehl
von Strehlitz, bald stockte und erst im Jahre 1609 unter Radslav v. Vchynice
weitergeführt wurde. Bis zu ihrer Einweihung diente den Bürgern die Kirche in
Dolní Podluží (Niedergrund).
Die Kirche ist ein rechteckiger, einschiffiger Bau mit einem dreiseitig abgeschlossenen
Presbyterium. Sie hat ein Tonnengewölbe mit Lünetten und Rippen, die auf Säulchen
mit von Gesimsen verziertenen Kapitellen aufgesetzt sind. An der Nordseite des
Schiffes ist ein Renaissance-Spitzbogenportal mit Seitennischen erhalten, ein
anderes Spitzbogenportal im Unterteil des Turmes führt in die Sakristei. An
die Nordseite der Kirche wurde später ein Turm angebaut, der vor 1664 fertig
wurde, da in diesem Jahre auf ihm neue Glocken angebracht wurden. Als aber im
Jahre 1783 der Oberteil des Turmes einstürzte, baute man einen neuen Barockturm,
auf dessen Oberteil im Jahre 1793 eine Kuppel aufgesetzt wurde, die angeblich
aus einem aufgelösten Kloster der Steiermark stammte. Im 19. Jahrhundert wurde
die Kirche neugotisch umgebaut. An der Aussenseite des an dem Turm anliegenden
Treppenhauses wurde ein Sandsteinrelief eines Kopfes eingesetzt, der angeblich
früher das Palais der Burg Tolštejn (Tollenstein)
schmückte. Bei der Renovation der Kirche um das Jahr 1914 wurde an ihrer Südseite
das Sandsteingewände einer Tür abgedeckt, die ursprünglich wahrscheinlich auf
den Friedhof führte, der bereits vor der Mitte des 17. Jahrhundert aufgelassen
wurde.

Das Innere der Kirche der Heiligen Dreifaltigkeit.
Foto: Jiří Kühn.
Die überwiegend barocke Inneneinrichtung stammt aus dem 18. Jahrhundert. Ausser dem im Jahre 1762 eingeweihten Hochaltar mit den Statuen des hl. Petrus und Paulus befinden sich hier zwei bildhauerisch gearbeitete Nebenaltäre des hl. hl. Joseph und Jesu Christi aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts und die Altäre der Jungfrau Maria und Jesu Christi aus der Zeit um 1800. Das Altarbild der heiligen Dreifaltigkeit und der Auferstehung Christi sind Werke des aus Jiřetín gebürtigen Joseph Birnbaum. Die Kanzel mit Beichtstühlen, die mit dem Relief des guten Hirten geschmückt sind, vefertigte im Jahre 1829 der Obergrunder Tischler Jakob Worm. Auf der dreiarmigen Empore befinden sich fünf barocke Statuen aus dem 18. Jahrhundert. Es sind dies der hl. Laurentius, die Immaculata, der hl. Johann Nep., die hl. Katharina und die Kreuzigung mit der Schmerzensmutter Maria. Ausserdem steht hier eine spätbarocke Statue des hl. Wenzel, ein Bild des hl. Sebastian, gemalt nach Tintoretto und ein Bildnis der hl. Cäcilie aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts.

Ehemaliges Pfarrhaus in der südöstlichen Ecke des Platzes.
Foto: Jiří Kühn.

Teilansicht der Bergbauexposition im Museum in Jiřetín.
Foto: Jiří Kühn.
In der südöstlichen Ecke des Marktes neben der Kirche steht die monumentale Pfarre mit ihrem Witschaftshofe, die in den Jahren 1753 bis 1755 an Stelle des ursprünglich hölzernen Hauses von 1616, das 1750 ausbrannte, gebaut wurde. Das barocke eingeschössige Bauwerk mit einem Mansardendache wird als das schönste Haus in Jiřetín bezeichnet und soll zu den prunkvollsten Gebäuden dieser Art in Nordböhmen gehören. Am 11. September wurde in seinen Räumen ein Museum eröffnet, das die älteste Vergangenheit der Stadt, die Geschichte der Burg Tolštejn und vor allem der schon vor Zeiten stillgelegten Gruben auf Edelmetalle dokumentiert.

Eine massive Eiche im Park in der Mitte des Platzes.
Foto: Jiří Kühn.
Der schön angelegte Park auf dem Marktplatz wird durch ein Bächlein mit einem Brunnen belebt, welches aus dem Überlauf eines Wasserbehälters gespeist wird, sowie durch einen Zierteich vor der Kirche, in dessen Mitte sich ein Springbrunnen befindet, der von einem Mobiltelefon gestartet werden kann. Im Mai 1998 wurde im ehemaligen Buswarteraum ein Informationszentrum mit einem weiteren Brunnen eröffnet. In der Mitte des Platzes steht eine große Eiche mit einer runden Bank, unter der die hohe Sandsteinsäule des hl. Laurentius aus dem Jahr 1716 steht, die nach örtlicher Überlieferung von dem örtlichen Steinmetz Wieden geschnitzt wurde. Die Inschrift auf der Vorderseite
des Sockels besagt, dass die Säule im Jahre 1802 zum Andenken an den Stadtbrand
am 11. August 1799 restauriert worden ist. Die zwei letzten Zeilen der Inschrift
auf der Rückseite enthalten in römischen Ziffern die Jahreszahl 1716.
Hinter der Kirche wächst die über 30 m hohe Jubiläumseiche, die 1908 zum 60-jährigen Regierungsjubiläum von Kaiser Franz Joseph I. mit einem Gedenkstein gepflanzt wurde. In ihrer Nachbarschaft steht eine ebenso alte Rotbuche mit 27 m Höhe. Beide Bäume wurden 2015 unter Naturschutz gestellt. Im südwestlichen Teil des Parks steht das ehemalige Denkmal für Friedrich Ludwig Jahn (1862-1912), den Begründer der deutschen Turnbewegung, das 1912 von den Jiretiner Turnern errichtet wurde, von dem nach dem Zweiten Weltkrieg aber nur noch ein leerer Stein übrig geblieben ist. Seit 1904 befand sich auf dem Platz auch ein Denkmal für die Kriegsopfer, das jedoch nach 1945 entfernt wurde.

St. Laurentius-Säule.
Foto: Jiří Kühn.

Jubiläums-Eiche, gepflanzt zum 60-jährigen Regierungsjubiläum von Kaiser Franz Joseph I. im Jahr 1908.
Foto: Jiří Kühn.

Mauer unterhalb des Hauses No. 252 mit den steinernen Wappen und dem Mundloch eines alten Stollens.
Foto: Jiří Kühn.
Jahrhunderte lang dominierte das Rathaus der Westseite des Marktes. Im Jahre 1776 wurde an Stelle des ursprünglich hölzernen Gebäudes ein spätbarockes einfaches einstöckiges Haus aufgebaut, an deren Stirnwand zwei Sandsteinschilde mit dem plastischen Stadtwappen und dem kolorierten Wappen der Herren v. Liechtenstein, der Besitzer der Herrschaft angebracht waren. Am 11. August 1799 verbrannte dieses Rathaus zusamen mit 12 anderen Häusern. Danach bauten die Bürger ein neues steinernes Gebäude, auf deren Stirnwand beide Wappen, die die Autonomie der Stadt und die Herrschaft symbolisieren sollten, wieder angebracht wurden. Im Jahre 1966 wurde dieses Rathaus zusammen mit drei benachbarten Häusern abgerissen und an seiner Stelle ein unansehnliches Einkaufszentrum aus Beton errichtet. Das Gemeindeamt befindet sich daher jetzt in einem eingeschössigen Eckhause oberhalb des Marktes.
Die steinernen Wappen vom abgerissenen Rathause wurden im Jahre 1976 in die Gartenmauer des Hauses No. 252 in der Křížová ulice (Kreuzgasse), gleich neben dem Mundloch angeblich eines der ältesten Stollen, die in den Křížová hora-Berg (Kreuzberg) getrieben worden sind, eingesetzt. Dieser Stollen, der heute "U císaře" (Zum Kaiser) genannt wird, wurde im Jahre 1891 zufällig beim Bau eines neuen Hauses entdeckt. Der Stollen wurde in südwestlicher Richtung im stark gestörten Granit vorgetrieben und ist nach etwa 30 m vollständig verbrochen.

Denkmalgeschütztes Haus Nr. 4 mit einem Eingangsportal aus Stein.
Foto: Jiří Kühn.
Im Städtchen hat sich eine ganze Zahl volkstümlicher Häuser aus dem 18. und 19. Jahrhundert erhalten, deren Aussehen sich auf die typische Lausitzer Holzbauweise, die in ihrem Aussehen und der inneren Anordnung den städtischen Anforderungen angepasst wurde, gründet. Esn überwiegen erdgeschössige oder einstöckige Umgebindehäuser, denen das Mansardendach und der schiefergedeckte Giebel einen gewissen Prunk verleiht. Das Obergeschoss war oft mit senkrecht angeordneten Brettern verschalt, deren Schmuck rauh bearbeitetes Mauerwerk imitierte. Einige Häuser haben auch klassizistisch ausgeschmückte Sandstein-Türstöcke. Die wertvollsten dieser Häuser stehen heute unter Denkmalschutz. Am Markt ist das das Reihenhaus No. 121 mit einem holzverschalten Obergeschoss und das Haus No. 4 mit einem steinernen Türstock, auf dem die Jahreszahl 1788 steht. In der Žižkova ulice-Gasse steht das kleine Blockhaus No. 145, ein Stück weiter bergauf sind zwei weitere Blockwandhäuser No. 162 und 164.

Blockwandhäuser in der Marktplatz.
Foto: Jiří Kühn.

Ein mustergültig gepflegtes Blockwandhaus.
Foto: Jiří Kühn.

Hauptgebäude des Klosters mit dem überirdischen Verbindungsgang zum benachbarten Objekte.
Foto: Jiří Kühn.
Die hinter der Kirche liegende Gasse führt zum Kloster, das hier im Jahre
1874 von der "Kongregation der Schwesten der Liebe Gottes" gegründet worden
ist. Seine Aufgabe war die Obsorge für Mädchen, die vom Lande zur Arbeit in
die Stadt kamen, und später auch die Pflege der alten Leute und Waisen. Das
Kloster war zuerst provisorisch im Hause No. 86 untergebracht, von wo es sich
im Jahre 1899 in das neugebaute Klostergebäude übersiedelte. Zu Ostern 1930
wurde gegenüber des alten Gebäudes ein neues Objekt mit einer Kapelle erbaut,
das mit dem alten Haus durch einen überirdischen Gang in der Höhe des ersten
Stockwerkes verbunden ist.
In den 50. Jahren wurde im Kloster ein Internat für Ordensschwestern errichtet,
in dem um 1970 über 250 Ordensschwestern aus mehr als acht verschiedenen Kongregationen
lebten. Erst anfangs der 90. Jahre konnte der Grossteil dieser Schwestern in
ihre ursprünglichen Klöster zurückkehren.

Blick vom Křížová hora (Kreuzberg) ins Tal.
Foto: Jiří Kühn.
Am Südwestrande des Städtches erhebt sich der steile Hang des Berges Křížová
hora (Kreuzberg) mit der aus dem 18. Jahrhundert stammenden renovierten
Wallfahrtskapelle.
Am Nordrande des Städtchens unterhalb des Marktplatzes liegt der Friedhof.
Er wurde in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderte an Stelle des ursprünglichen,
die Kirche am Marktplatz umgebenden Friedhofes gegründet. Der älteste Grabstein
mit der Jahreszahl 1635 befindet sich in der Südmauer des Friedhofes, gleich
neben dem im Jahre 1748 gebauten Totenhause. Um das Jahr 1761 ist die Friedhofskapelle
gebaut worden, die urprünglich eine Miniatur der Klosterkirche in Sedlec bei
Kutná Hora darstellte. Im Jahre 1822 wurde sie aber umgebaut und ihre heutige
Gestalt erhielt sie im Jahre 1840, in dem der ganze Friedhof parkmässig umgestaltet
und mit einer Mauer umgeben wurde. Im Innenraum der Kapelle wurden nach und
nach die Gedenktafeln der hiesigen Priester installiert. Das auf einem Granitsockel
stehende gusseiserne Kreuz wurde am 8. Juli 1845 eingeweiht.
Das Städtchen wird auch durch einige Kleinplastiken belebt. Auf dem Platz unterhalb des Pfarrhauses steht seit dem 1. Juli 2011 eine Statue des heiligen Johannes von Nepomuk, die der Stadt von den Bürgern Dagmar und Karel Suchý aus Nebřenice bei Říčany gestiftet wurde. An der Straße nach Rybniště steht die Sandsteinstatue der heiligen Anna aus dem Jahr 1769 und an der Straße nach Tolštejn befindet sich zwischen zwei Bäumen ein dekoratives Eisenkreuz auf einem Steinsockel aus dem Jahr 1826.

Statue der Heiligen Anna.
Foto: Jiří Kühn.

Kreuz an Straße nach Tolštejn.
Foto: Jiří Kühn.
In der Gasse unterhalb des Postamtes befindet sich das Gebäude der ehemaligen Schraubenfabrik, in der im Zweiten Weltkriege eine Zweigstelle des Konzentrationslagers Flossenbürg bestand. Im Jahre 1982 wurde hier eine kleine Gedenktafel angebracht, die aber später entfernt wurde.
Im Laufe der 60er bis 80er Jahre wurde am Nordabhange des Jedlová-Berges (Tannenberg) oberhalb des abgelegenen Ortsteiles Rozhled ein Skisportareal eingerichtet, wodurch Jiřetín zu einem bedeutenden Wintersportzentrum wurde. Im Jahre 1983 begann die Sportvereinigung Slovan am Ostrande des Städtchens mit dem Bau eines Sommersportzentrums, das heute eine ganze Reihe von Möglichkeiten der aktiven Erholung und Entspannung anbieten kann. Zur Verfügung stehen einige Spielplätze, eine Leichtathletikbahn, ein Schwimmbassin, eine Minigolf-Anlage, Tennisplätze, Tischtennis und eine Sauna. Im Angebot ist auch die Möglichkeit von Reitausflügen und seit 1996 ist auch ein ehemals privater zoologischer Garten, der als Ruheplatz dient, in die Anlagen einbezogen worden. Am Westrande des Städtchens am Abhange des Křížová hora-Berges befindet sich ein kleiner Golfplatz.
Die Anstrengungen der hiesigen Einwohner und Landhausinhaber um die Verschönerung des Städtchens und die Belebung seines kulturellen Lebens wurden im Jahre 1998 durch die Beleihung mit dem Prestigetitel "Dorf des Jahres" gewürdigt.
Bedeutende Landsleute und Persönlichkeiten
In Jiřetín wurden geboren die Kirchenmaler Anton Donat
(*1746) und Johann Birnbaum (1793 –1872) und der Landschafts- und Porträtmaler
Wenzel Salomon (1874 - 1953), der auch das Aussehen des Städtchens und
seiner Umgebung in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts für die Nachwelt festhielt.
Zu den bedeutendsten Landsleuten gehört auch der Violinvirtuose Franz Anton
Ernst (1745 - 1805), der als Konzertmeister der Hofkapelle im thüringischen
Gotha wirkte, und Johann Alois Miksch (1765 - 1845), der durch seine
Sopranstimme zuerst in der Katholischen Hofkirche, später in der kurfürstlichen
Italienischen Oper und schliesslich als Direktor des Opernchores in Dresden
berühmt wurde.
Sehenswürdigkeiten in der Umgebung
Die Anziehungskraft ses Städtchens Jiřetín wird erhöht durch seine einzzigartige Lage in der malerishen Gegend des Lausitzer Gebirges. Die weite Umgebung beherrscht der mächtige Jedlová-Berg (Tannenberg) mit seinem Aussichtsturm und der Gaststätte auf dem Gipfel, von dem der Rücken des Křížová hora-Berges (Kreuzberg) mit dem erneuerten Wallfahrtsort und den alten Silberbergwerken bis dicht an den Rand des Städtchens heranreicht. In den ausgedehnten Wäldern des Südhanges des Jedlová-Berges glänzen die malerischen Jedlovské rybníky (Tannteiche), westlich von ihnen ragt der charakteristische Felsgipfel des Malý Stožec-Berges (Kleiner Schöber) aus den Wäldern, an dessen Südfusse sich eine kleine Höhle befindet. Im Tale unterhalb des Nordostabhanges des Jedlová-Berges sieht man die Sommerfrischen Lesné, Jedlová und Rozhled, über denen sich der weithin sichtbare Burgfelsen mit der Ruine Tolštejn (Tollenstein) erhebt. Unterhalb der Burg liegt der von Sagen umsponnene Míšeňská dolina (Meisen- oder Meissnergrund), hinter dem am Horizont der Rücken der Jelení kameny (Hirschensteine) mit ihrem Aussichtsfelsen und das breite Massiv des bis zur tschechisch-deutschen Staatsgrenze reichenden Pěnkavčí vrch (Finkenkoppe) aufsteigt. Zwischen den westlichen Ausläufern des Pěnkavčí vrch, den markanten Rücken des Rohál (Hörndel) und Čertova pláň (Teufelsplan), liegt das tiefeingeschnittene Tal údolí Milířky (Kohlhautal) mit einem Bergbau-Lehrpfad. Im Tale des Lužnička-Baches (Lause- oder Lauschebach) nördlich von Jiřetín breitet sich ein zusammenhängendes, aus den Ortschaften Horní und Dolní Podluží (Ober- und Niedergrund) gebildetes Siedlungsgebiet aus. Bei Horní Podluží liegen zwei als Nistplätze für Wasservögel geschützte Teiche. Im Westen ist das der Velký rybník (Bernsdorfer Teich) und im Norden der Světlík-Teich (Lichtenberger Teich), an dessen Ufer auch das Torso einer Windmühle steht.